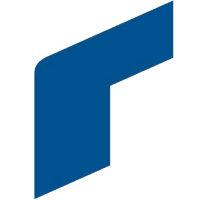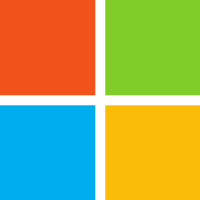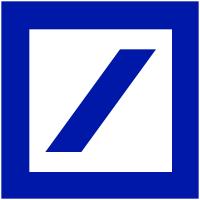Die deutschen Freunde sagen: Versprich, dass du nicht nach Japan fährst. Von dort heißt es: Hier herrscht keine Panik, das Trinkwasser ist sauber, die Züge fahren pünktlich. Unser Autor ist gefahren. Ein Familienbesuch in Japan.
Wir schwitzen, uns steht das Wasser bis zum Hals, 42 Grad heiß, direkt aus dem Vulkangestein. Im März bebte im Norden die Erde, riss der Tsunami Menschen, Fabriken und Züge mit. Jetzt sitze ich mit meinem japanischen Halbbruder in einem Bad auf der Insel Shikoku, neben uns lachen die Handwerker. Im Fernsehen wird eine Popsängerin interviewt. Man kann sich die Frage eines Johannes B. Kerner vorstellen: „Als Sie die Bilder aus Fukushima gesehen haben – was haben Sie da gespürt?“ Der Moderator erwähnt das Thema mit keinem Wort. „Das passt nicht in eine Unterhaltungssendung“, erklärt mir mein Bruder.
Meine Freunde in Deutschland bedrängten mich: Versprich mir, dass du nicht nach Japan fährst.
Du liest die Nachrichten. Was muss noch passieren, damit du den Flug stornierst? Mein Vater schrieb: Hier herrscht keine Panik, das Trinkwasser ist sauber, die Züge fahren pünktlich.
1994 war ich zum ersten Mal in Japan gewesen. Mein Vater renovierte gerade ein traditionelles Holzhaus im Norden Osakas. Bald nach meinem Besuch kam das Erdbeben von Kobe, und die Arbeit meines Vaters knickte zusammen wie Streichhölzer. Nun war ich für ein Musikfestival in Südkorea und hatte den Rückflug über Tokio gebucht. Das Eröffnungskonzert wäre fast geplatzt, weil das Salzburger Mozarteum-Orchester in letzter Minute nicht ins Flugzeug stieg: Strahlungsangst. Mit der kurzfristigen Entscheidung hatte es gleich noch den Ersatz ausgebootet: Die Philharmoniker von Sendai standen im Vorfeld bereit.
So wollte ich nicht sein. Ich wollte so besonnen sein wie die Japaner.
Die ersten Japaner, die ich im Schlafraum der Fähre von Pusan nach Shimonoseki treffe, sind bekiffte Rastafaris. Sie haben in Korea Konzerte gegen Atomkraft gegeben. Sie erklären mir, das kapitalistische Babylon töte gezielt Vertreter regenerativer Energien. Sie halten mir auf dem Smartphone eine Karte des Deutschen Wetterdienstes unter die Nase, derzufolge der Wind die Strahlung aus Fukushima über ganz Japan trägt.
Na toll, denke ich, als ich mit wackligen Beinen vom Schiff steige. Es ist der Tag, an dem die Japaner zu ahnen beginnen, dass der Rest der Welt besser informiert ist als sie. Mein Bruder wartet in Hiroshima auf mich. Eine ruhige Großstadt im Frühlingslicht, Picknicker sitzen unter den Kirschblüten am Ota-Fluss, in den am 6. August 1945 die Opfer gesprungen waren, um ihre Verbrennungen zu kühlen. Die Kirschblüte: Ende März beginnt sie im Süden auf Kyushu und zieht dann als üppiges weißrosa Band über Kyoto, Tokio und Sendai bis hoch nach Hokkaido. Nach zehn Tagen sind die Blüten abgefallen. „Wie die weißen Kirschblüten / Die ein Windstoß zum Himmel trägt / So werden die Helden / In den Wolken emporsteigen“, sangen die Witwen im Zweiten Weltkrieg. Überall lagern Gruppen zum Hanami, dem traditionellen Kirschblütenfest, unter den Bäumen, in den Parks von Kyoto, auf dem Burgberg in Matsuyama, wo das Dogo Onsen steht, das älteste heiße Bad Japans.
Bald gibt es weniger Fisch
Es ist die schönste Zeit des Jahres. Es ist die Zeit der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Lautsprecherwagen machen Werbung für die Kommunalwahlen. „Es wird jetzt bald weniger Fisch geben“, sagt mein Bruder, während wir im Schneidersitz über Thunfisch, Garnelen und Aal sitzen. Er lacht mich aus dafür, dass ich mir wegen möglicher Strahlung Sorgen um unsere Zeugungsfähigkeit gemacht habe. Der große Bruder schnorrt dem kleinen die Zigaretten weg, die letzten Vorräte aus den Tabakfabriken in Sendai.
Mein Bruder ist 18, er macht nächstes Jahr Abitur. Er hat zwei Pässe und muss sich entscheiden, welchen er behält. Er ging auch schon in Deutschland zur Schule. Seine Gastmutter stellte ihm Fragen wie: „Sag mal, wie denkst du über Walfang?“ Die Schweigsamkeit des Jungen, der in den ruppigen Gesprächen beim Abendessen unterging, beunruhigte sie. „Also wenn was über Walfang im Fernsehen kommt“, sagte die Gastmutter, und ich stelle mir vor, wie sie dabei an ihrem Wurstbrot kaut, „kann ich gar nicht hinschauen, so furchtbar ist das.“
Der deutsche Blick auf die Fremde: Man reduziert sein Gegenüber auf den Japaner, konstruiert so viele Unterschiede wie möglich. Dann arbeitet man sich an diesen Unterschieden ab. Die Gastmutter hätte auch sagen können: „Ich bin moralisch so überlegen, dass ich gar nicht in der Lage bin, mich mit so grässlichen Dingen zu beschäftigen.“
Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass Deutsche im Rest der Menschheit lauter verhinderte Deutsche sehen, die von seltsamen Bräuchen davon abgehalten werden, sich normal zu verhalten. Warum weinen die Opfer nicht? Warum gehen sie nicht demonstrieren? Warum sind sie nicht längst in unseren großzügig angebotenen Wohnungen?
Wir sitzen über einem dampfenden Nabe-Eintopf, da zeigt mein Bruder auf den Fernseher hinter mir: „Ein Erdbeben.“ Gerade läuft „Da Vinci Code 2“, darüber kündet eine Meldung von einem Nachbeben bei Sendai. „Das ist normal“, sagt mein Bruder. Erst vor zwei Tagen wurden vor der Küste von Sendai wieder 7,1 gemessen. Jeden Moment könnte mit einem neuen Beben die Situation in Fukushima eskalieren. Doch mein Bruder und ich machen Urlaub. Wir sehen den goldüberzogenen Kinkaku-Tempel in Kyoto. Wir sehen die aus Schlingpflanzenranken geflochtene Kazurabashi-Hängebrücke auf Shikoku. Wir dampfen in einer schwefelhaltigen Quelle im versteckten Iya-Tal.
Fukushima ist ein Scheinriese
Ich frage meinen Bruder, ob er sich an den Scheinriesen aus „Jim Knopf“ erinnert. Aus der Ferne wirkt er groß, doch je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er. Der Scheinriese steht am Ende der Welt und rät Jim Knopf und dem Lokomotivführer von der Weiterreise ab. Die hören nicht auf ihn. Fukushima ist ein Scheinriese. Nie war ich in den letzten Wochen weiter weg von der Katastrophe als jetzt, wo ich ihr am nächsten bin.
Was soll man tun, wenn man betroffen ist? Man räumt auf. Man spart Wasser. Man spart Strom. Vielleicht sieht man aus der Ferne mehr. Doch unser Entsetzen, unsere Empörung, der Alarmton, der glauben lässt, ganz Japan sei bald nukleare Wüste: Das ist auch ein Luxus derer, die es sich leisten können.
Natürlich sind die Folgen des Bebens allgegenwärtig. In den Militärkolonnen, die nach Norden fahren. Im gedämpften Ton beim Kirschblütenpicknick. In Spendenaufrufen. In den Wunschzetteln, die neben dem Karpfenteich der Shogun-Residenz in Kyoto an einen großen Papierkarpfen geheftet sind. Aber die Atomapokalypse ist eine deutsche Fantasie. Sie hat ihren Ursprung und ihren Sinn bei den Betrachtern, weniger bei den Betroffenen.
„Panik hilft niemandem“, erklärt mir mein Bruder, während wir in der Sauna schwitzen. „Wir konzentrieren uns auf das, was wir tun können“. Ich freue mich, dass er „wir“ sagt, dass mein Bruder in dem Moment weiß, dass er Japaner ist. „Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du gerade jetzt nach Japan kommst“, sagt die Mutter meines Bruders am Ende der Reise. „Ich habe nach dem Erdbeben als Erstes die deutschen Reisepässe der Kinder geprüft. Sie liegen immer bereit.“ Plötzlich sehe ich uns mit dem deutschen Blick in Japan stehen, 15000 Menschen sind gestorben und 562 Kilometer neben uns schwelt ein Atomkraftwerk.
Seit ich zurück bin, lese ich wieder täglich die Nachrichten aus Fukushima.
www.tagesspiegel.de/kultur/...und-strahlungsangst/4148708.html
Wir schwitzen, uns steht das Wasser bis zum Hals, 42 Grad heiß, direkt aus dem Vulkangestein. Im März bebte im Norden die Erde, riss der Tsunami Menschen, Fabriken und Züge mit. Jetzt sitze ich mit meinem japanischen Halbbruder in einem Bad auf der Insel Shikoku, neben uns lachen die Handwerker. Im Fernsehen wird eine Popsängerin interviewt. Man kann sich die Frage eines Johannes B. Kerner vorstellen: „Als Sie die Bilder aus Fukushima gesehen haben – was haben Sie da gespürt?“ Der Moderator erwähnt das Thema mit keinem Wort. „Das passt nicht in eine Unterhaltungssendung“, erklärt mir mein Bruder.
Meine Freunde in Deutschland bedrängten mich: Versprich mir, dass du nicht nach Japan fährst.
Du liest die Nachrichten. Was muss noch passieren, damit du den Flug stornierst? Mein Vater schrieb: Hier herrscht keine Panik, das Trinkwasser ist sauber, die Züge fahren pünktlich.
1994 war ich zum ersten Mal in Japan gewesen. Mein Vater renovierte gerade ein traditionelles Holzhaus im Norden Osakas. Bald nach meinem Besuch kam das Erdbeben von Kobe, und die Arbeit meines Vaters knickte zusammen wie Streichhölzer. Nun war ich für ein Musikfestival in Südkorea und hatte den Rückflug über Tokio gebucht. Das Eröffnungskonzert wäre fast geplatzt, weil das Salzburger Mozarteum-Orchester in letzter Minute nicht ins Flugzeug stieg: Strahlungsangst. Mit der kurzfristigen Entscheidung hatte es gleich noch den Ersatz ausgebootet: Die Philharmoniker von Sendai standen im Vorfeld bereit.
So wollte ich nicht sein. Ich wollte so besonnen sein wie die Japaner.
Die ersten Japaner, die ich im Schlafraum der Fähre von Pusan nach Shimonoseki treffe, sind bekiffte Rastafaris. Sie haben in Korea Konzerte gegen Atomkraft gegeben. Sie erklären mir, das kapitalistische Babylon töte gezielt Vertreter regenerativer Energien. Sie halten mir auf dem Smartphone eine Karte des Deutschen Wetterdienstes unter die Nase, derzufolge der Wind die Strahlung aus Fukushima über ganz Japan trägt.
Na toll, denke ich, als ich mit wackligen Beinen vom Schiff steige. Es ist der Tag, an dem die Japaner zu ahnen beginnen, dass der Rest der Welt besser informiert ist als sie. Mein Bruder wartet in Hiroshima auf mich. Eine ruhige Großstadt im Frühlingslicht, Picknicker sitzen unter den Kirschblüten am Ota-Fluss, in den am 6. August 1945 die Opfer gesprungen waren, um ihre Verbrennungen zu kühlen. Die Kirschblüte: Ende März beginnt sie im Süden auf Kyushu und zieht dann als üppiges weißrosa Band über Kyoto, Tokio und Sendai bis hoch nach Hokkaido. Nach zehn Tagen sind die Blüten abgefallen. „Wie die weißen Kirschblüten / Die ein Windstoß zum Himmel trägt / So werden die Helden / In den Wolken emporsteigen“, sangen die Witwen im Zweiten Weltkrieg. Überall lagern Gruppen zum Hanami, dem traditionellen Kirschblütenfest, unter den Bäumen, in den Parks von Kyoto, auf dem Burgberg in Matsuyama, wo das Dogo Onsen steht, das älteste heiße Bad Japans.
Bald gibt es weniger Fisch
Es ist die schönste Zeit des Jahres. Es ist die Zeit der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Lautsprecherwagen machen Werbung für die Kommunalwahlen. „Es wird jetzt bald weniger Fisch geben“, sagt mein Bruder, während wir im Schneidersitz über Thunfisch, Garnelen und Aal sitzen. Er lacht mich aus dafür, dass ich mir wegen möglicher Strahlung Sorgen um unsere Zeugungsfähigkeit gemacht habe. Der große Bruder schnorrt dem kleinen die Zigaretten weg, die letzten Vorräte aus den Tabakfabriken in Sendai.
Mein Bruder ist 18, er macht nächstes Jahr Abitur. Er hat zwei Pässe und muss sich entscheiden, welchen er behält. Er ging auch schon in Deutschland zur Schule. Seine Gastmutter stellte ihm Fragen wie: „Sag mal, wie denkst du über Walfang?“ Die Schweigsamkeit des Jungen, der in den ruppigen Gesprächen beim Abendessen unterging, beunruhigte sie. „Also wenn was über Walfang im Fernsehen kommt“, sagte die Gastmutter, und ich stelle mir vor, wie sie dabei an ihrem Wurstbrot kaut, „kann ich gar nicht hinschauen, so furchtbar ist das.“
Der deutsche Blick auf die Fremde: Man reduziert sein Gegenüber auf den Japaner, konstruiert so viele Unterschiede wie möglich. Dann arbeitet man sich an diesen Unterschieden ab. Die Gastmutter hätte auch sagen können: „Ich bin moralisch so überlegen, dass ich gar nicht in der Lage bin, mich mit so grässlichen Dingen zu beschäftigen.“
Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass Deutsche im Rest der Menschheit lauter verhinderte Deutsche sehen, die von seltsamen Bräuchen davon abgehalten werden, sich normal zu verhalten. Warum weinen die Opfer nicht? Warum gehen sie nicht demonstrieren? Warum sind sie nicht längst in unseren großzügig angebotenen Wohnungen?
Wir sitzen über einem dampfenden Nabe-Eintopf, da zeigt mein Bruder auf den Fernseher hinter mir: „Ein Erdbeben.“ Gerade läuft „Da Vinci Code 2“, darüber kündet eine Meldung von einem Nachbeben bei Sendai. „Das ist normal“, sagt mein Bruder. Erst vor zwei Tagen wurden vor der Küste von Sendai wieder 7,1 gemessen. Jeden Moment könnte mit einem neuen Beben die Situation in Fukushima eskalieren. Doch mein Bruder und ich machen Urlaub. Wir sehen den goldüberzogenen Kinkaku-Tempel in Kyoto. Wir sehen die aus Schlingpflanzenranken geflochtene Kazurabashi-Hängebrücke auf Shikoku. Wir dampfen in einer schwefelhaltigen Quelle im versteckten Iya-Tal.
Fukushima ist ein Scheinriese
Ich frage meinen Bruder, ob er sich an den Scheinriesen aus „Jim Knopf“ erinnert. Aus der Ferne wirkt er groß, doch je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er. Der Scheinriese steht am Ende der Welt und rät Jim Knopf und dem Lokomotivführer von der Weiterreise ab. Die hören nicht auf ihn. Fukushima ist ein Scheinriese. Nie war ich in den letzten Wochen weiter weg von der Katastrophe als jetzt, wo ich ihr am nächsten bin.
Was soll man tun, wenn man betroffen ist? Man räumt auf. Man spart Wasser. Man spart Strom. Vielleicht sieht man aus der Ferne mehr. Doch unser Entsetzen, unsere Empörung, der Alarmton, der glauben lässt, ganz Japan sei bald nukleare Wüste: Das ist auch ein Luxus derer, die es sich leisten können.
Natürlich sind die Folgen des Bebens allgegenwärtig. In den Militärkolonnen, die nach Norden fahren. Im gedämpften Ton beim Kirschblütenpicknick. In Spendenaufrufen. In den Wunschzetteln, die neben dem Karpfenteich der Shogun-Residenz in Kyoto an einen großen Papierkarpfen geheftet sind. Aber die Atomapokalypse ist eine deutsche Fantasie. Sie hat ihren Ursprung und ihren Sinn bei den Betrachtern, weniger bei den Betroffenen.
„Panik hilft niemandem“, erklärt mir mein Bruder, während wir in der Sauna schwitzen. „Wir konzentrieren uns auf das, was wir tun können“. Ich freue mich, dass er „wir“ sagt, dass mein Bruder in dem Moment weiß, dass er Japaner ist. „Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass du gerade jetzt nach Japan kommst“, sagt die Mutter meines Bruders am Ende der Reise. „Ich habe nach dem Erdbeben als Erstes die deutschen Reisepässe der Kinder geprüft. Sie liegen immer bereit.“ Plötzlich sehe ich uns mit dem deutschen Blick in Japan stehen, 15000 Menschen sind gestorben und 562 Kilometer neben uns schwelt ein Atomkraftwerk.
Seit ich zurück bin, lese ich wieder täglich die Nachrichten aus Fukushima.
www.tagesspiegel.de/kultur/...und-strahlungsangst/4148708.html
 Werbung
Werbung