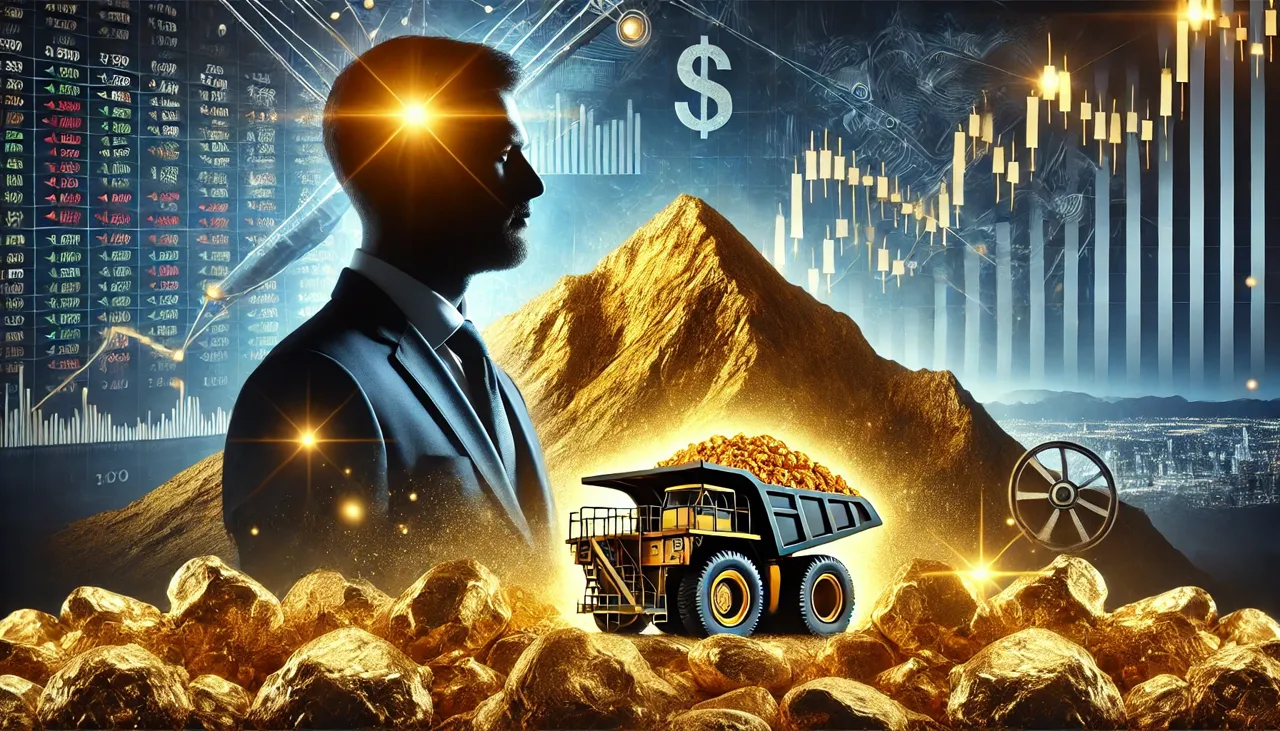thema 1: RENTE
Wer sichert das Alter?
Am Donnerstag, 5. September um 18:30 Uhr untersucht n-tv die Antworten der Parteien auf die Frage: Wer sichert das Alter? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutiert n-tv-Moderator Lars Brandau gemeinsam mit Rudolf Hickel, Wissenschaftlicher Direktor am PIW-Institut für Wirtschaftsforschung und Meinhard Miegel, Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft in Bonn.
Mittlerweile glauben die meisten jungen Deutschen, dass sie im Alter sowieso nicht mehr auf die staatliche Rente bauen können. Trotz Riester-Reform springt aber auch die private Vorsorge für das Alter nicht an. Die Probleme sind da: Immer weniger arbeitende Menschen müssen immer mehr Rentner versorgen. Doch eine tiefgreifende Reform des Systems hat bisher noch keine Regierung angepackt.
Wird es nun in der kommenden Legislaturperiode eine Partei wagen, eine mutige Rentenreform durchzusetzen? Die SPD beruft sich in ihrem Programm auf die Riesterreform und will die Rente von versicherungsfremden Leistungen befreien. Die CDU hält die Riester- Reform für unzureichend und „notwendige Korrekturen“ durchführen. Dass eine zusätzliche private Vorsorge nötig ist, darüber herrscht weitgehend Einvernehmen. Wie groß dieser Anteil sein soll, ist noch strittig. Die FDP sieht die private Komponente bei 50 Prozent. Damit will die FDP auf längere Sicht weg von den umlagefinanzierten Renten und hin zu einer beitragsfinanzierten Grundsicherung.
Nach dem Willen aller Parteien außer der PDS soll die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Anreize zur Frühverrentung und Altersteilzeit sollen abgeschafft oder nur noch bedingt gefördert werden. Die CDU will das tatsächliche Eintrittsalter dem gesetzlichen anpassen. Die FDP will eine Verlängerung auch durch einen früheren Eintritt in die Berufstätigkeit erreichen - etwa durch eine Aussetzung der Wehrpflicht und eine Verkürzung der Berufsbildungs- und Ausbildungszeiten.
In allen Programmen finden sich auch Vorschläge dazu, ob die Rente in Zukunft auch besteuert wird. Die Grünen schlagen vor, die Sozialversicherungsbeiträge von der Steuer zu befreien und eine „konsequente nachgelagerte Besteuerung einzuführen. Einzig die PDS weicht in vielen Punkten von den anderen Parteien ab und will etwa alle Erwerbseinkommen der Versicherungspflicht unterwerfen oder die betriebliche Altersvorsorge zur „vorrangigen Sicherungsform“ machen.
thema2: Aufbau Ost
Aufbau Ost: Arbeitsplätze sind Mangelware
Die Sendung am Donnerstag, den 15. August um 18:30 Uhr zum Thema Aufbau Ost musste wegen der Berichterstattung zur Flutkatastrophe im Osten Deutschlands leider ausfallen. Dennoch sehen sie hier die Beurteilung der Experten und die "Noten" (siehe Link).
Die Probleme des Ostens sind nach wie vor, auch ohne Jahrhundertflut, gravierend. Der wirtschaftliche Aufbau in den neuen Ländern kommt nicht voran. Seit zwei Jahren liegt das Wachstum dort sogar unter dem Niveau der alten Länder. Ergebnis: das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Osten erreicht aktuell nur knapp 62 Prozent des Westniveaus. Dennoch sollen Löhne, Renten und andere Leistungen bald angeglichen werden, doch nicht alle Unternehmen im Osten werden dies überleben. Nach Ansicht der EU-Kommission sind die Spätfolgen der Wiedereinigung zu zwei Dritteln für die gesamtdeutsche Wachstumsschwäche verantwortlich.
Auf dem Arbeitsmarkt stellt sich die Lage dramatisch dar. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) schätzt, dass in diesem Jahr die Zahl der Erwerbstätigen um 96.000 sinkt. Im ersten Arbeitsmarkt wird demnach die Zahl der Arbeitsplätze um 113.000 sinken. Besonders betroffen seien die öffentliche Verwaltung und das Baugewerbe. Die Arbeitslosenquote in den neuen Ländern dürfte weiter steigen und auf dem Höchstwert von rund 18 Prozent verharren. Das Schlusslicht in der Arbeitslosenstatistik ist Sachsen-Anhalt mit einer Quote von 19,8 Prozent.
Im Jahr 2001 wurden staatliche Beschäftigungsprogramme stark zurückgefahren. Das IWH hat errechnet, dass in diesem Jahr aber wieder rund 16.000 Personen oder neun Prozent mehr in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert werden, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa drei Prozent der ostdeutschen Erwerbstätigen werden dann im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sein.
Die Parteien haben in ihren Wahlprogrammen dem „Aufbau Ost“ lange Kapitel gewidmet, einzig der FDP ist der Osten ganze drei Seiten wert. Die Rede ist viel von regionaler Förderung, der Verzahnung von Forschung und Wirtschaft und der Unterstützung von Gründern. Einig ist man sich offenbar, dass man im Kleinen beginnen muss, um vielleicht in einigen Jahren positive Effekte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu erreichen.
Unterschiede gibt es hingegen bei den Vorschlägen zur Lösung der Probleme auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt. SPD, Grüne und PDS wollen die umstrittenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fortführen, die Union will nur noch ältere Arbeitnehmer in ABM beschäftigen, die FDP mittelfristig ganz auf ABM verzichten.
Nicht einig sind sich die Parteien auch, wie bald die Löhne im Osten auf Westniveau angehoben werden sollen. Im öffentlichen Dienst ist vorgesehen, dass die Gehälter bis 2007 auf Westniveau angehoben werden. Beide große Parteien wollen das auch so durchführen, die CDU/CSU betont aber auch, wie wichtig differenzierte Löhne sind. PDS und Grüne bestehen allerdings auf einem festen Fahrplan zur Lohnangleichung. Dieses Konzept erntete Kritik. Martin Rosenfeld vom Institut für Wirtschafstforschung in Halle (IWH): „Die Lohnanpassung sollte Tarifverträgen und den Betrieben überlassen bleiben, die Politik sollte sich hiervon fernhalten. Höchstens im öffentlichen Dienst könnte die Politik gewisse Signale setzen."
Das alle Parteien die Investitionszulage fortführen wollen, findet die Zustimmung der Experten. Rudolf Hickel: "Die Investitionsförderung darf aber nicht nur bei Sachinvestitionen ansetzen, sondern muss verbunden werden mit der Durchsetzung von qualitativen Produktionskonzepten.“
thema 3: Arbeitsamt-Reform
Wer reformiert das Arbeitsamt?
Am Donnerstag, 22. August um 18:30 Uhr, untersuchte n-tv die Antwort der Parteien auf die Frage: Wer reformiert die Bundesanstalt für Arbeit? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutierte n-tv- Moderator Lars Brandau gemeinsam mit Rudolf Hickel vom PIW Institut für Wirtschaftsforschung und Meinhard Miegel, Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht bei allen Parteien an erster Stelle der Agenda im Wahlkampf. Dabei gibt es erstaunlich viel Gemeinsamkeiten bei allen Parteien, mit Ausnahme der PDS, die in vielen Dingen doch einen Sonderweg einschlägt.
So ist es offensichtlich Konsens, dass Sozial- und Arbeitshilfe gebündelt werden müssen und ein neue Form von sozialer Grundsicherung eingeführt werden soll. Die SPD lehnt allerdings eine Leistungskürzung bislang ab. Bei der CDU ist man sich noch nicht sicher: Späth sagt Ja, Stoiber beharrt auf Nein. Die Vorschläge der „Hartz-Kommission“, die sogar eine Pauschalierung der Arbeitslosenunterstützung vorsehen, bringen immerhin einen ganz neuen Aspekt in die Diskussion.
Die FDP plant die Entkoppelung der sozialen Sicherung vom Arbeitseinkommen. Die Sozialversicherungspflicht wird von einer Versicherungspflicht für eine Grundsicherung abgelöst werden. Alle sozialen Hilfeleistungen werden als Bürgergeld gezahlt. Anreize bei Arbeitsaufnahme müssen eingeführt werden, das Arbeitslosengeld wird nur 12 Monate gezahlt.
Die Arbeitsverwaltung und -vermittlung wollen alle Parteien gründlich reformieren. Private Job-Agenturen sollen es richten, die zum Teil in Konkurrenz zu Arbeitsämtern operieren sollen. Die Landesarbeitsämter sollen aufgelöst werden. So soll die Vermittlungsdauer verkürzt und der mäßige Erfolg bei der Vermittung von neuen Stellen verbessert werden.
Doch so einfach geht es offenbar nicht. Meinhard Miegel: „Ich halte nichts davon die Bundesanstalt im Ergebnis durch die Auflösung der Landesarbeitsämter aufzuwerten. Weil das Arbeitsmarktproblem in hohem Maße ein regionales Problem ist und die Unterschiede zwischen den Regionen beträchtlich sind, hätte ich umgekehrt dafür plädiert, die Landesarbeitsämter zu stärken.“
Auch bei den Grünen geht es um eine effektivere Arbeitsvermittlung und wird über die Wahlfreiheit zwischen staatlichen und privaten Vermittlern nachgedacht. Den zukünftigen Mitarbeitern des Arbeitsamtes soll der Beamtenstatus aberkannt werden.
CDU, SPD und Grüne wollen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Osten fortsetzen, die PDS hält sie gar für unverzichtbar. Die FDP will die ABM deutlich einschränken und schlechter bezahlen.
thema 4: STEUERN
Steuerpolitik: Prozente und Paragrafen
Am Donnerstag, 29. August um 18:30 Uhr untersuchte n-tv die Antworten der Parteien auf die Frage: Wer schafft ein verständliches Steuersystem? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutierte n-tv-Moderator Lars Brandau mit Rudolf Hickel, Wissenschaftlicher Direktor am PIW-Institut für Wirtschaftsforschung, und Jochen Sigloch, Steuerexperte von der Universität Bayreuth.
In der Steuerpolitik stehen sich die Parteien näher, als sie nach außen hin zugeben. Da bei ist es letztlich unerheblich, ob der Spitzsteuersatz 35 Prozent (wie bei der FDP) oder 40 Prozent (wie bei der CDU) oder 42 Prozent (wie bei SPD und Grünen) beträgt. Wesentlicher wird sein, wer es schafft das Steuersystem so umzubauen, dass Ausnahmen wegfallen und die Belastung der Bürger insgesamt sinkt.
Alle Vorschläge, die eine Senkung der Einkommenssteuersätze beinhalten, stehen sowieso unter dem "Finanzierungsvorbehalt". Da sich die Bundesregierung an das Maastrichter Defizitkriterium halten muss, muss sie das Geld, was sie durch Steuersenkungen verliert, an anderer Stelle wieder hereinholen. Darüber findet sich aber nicht viel in den Parteiprogrammen.
Aussagen dazu, wo und wie gespart werden soll, erschöpfen sich zu allgemeinen Willenserklärungen zum Subventionsabbau. Dem Kohlebergbau geht es nach dem Willen der FDP und den Grünen an den Kragen, die Grünen wollen zusätzlich die Landwirtschaft mehr zur Kasse bitten und die Entfernungspauschale abbauen.
Die SPD will die Ökosteuer nach 2003 nicht weiter erhöhen und wie vorgesehen die Reform der Einkommenssteuer bis 2005 umsetzen. Dadurch wird der Eingangssteuersatz bei 15, und der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent liegen. Rudolf Hickel kritisierte in der Sendung die Ökosteuer-Pläne: „Wenn man die Ökosteuer ernst nimmt, braucht übrigens auch die Wirtschaft eine mittelfristige Planbarkeit. Das Projekt einfach abzubrechen, wäre eine Katastrophe. Es muss fortgeführt werden, mit einigen Änderungen. Jetzt einfach auszusteigen, denunziert die gesamte Idee der Ökosteuer.“
Die CDU/CSU will die Ökosteuer aussetzen und mittelfristig durch eine Schadstoffabgabe ersetzen. Sie schlägt einen Eingangssteuersatz von 15 Prozent vor und will den Höchststeuersatz bis 2006 auf 40 Prozent bei einem flachen linearen Tarifverlauf senken. Steuersubventionen und Ausnahmen werden gestrichen.
Die Grünen wollen die Steuerreform weiter umsetzen und Steuervergünstigungen abbauen. Der Grundfreibetrag wird 7664 Euro angehoben und kleinere und mittlere Einkommen entlastet. Im Gegensatz zu den anderen Parteien wollen die Grünen die Ökosteuer weiterentwickeln, die Lohnnebenkosten weiter senken und öffentliche Verkehrsmittel subventionieren, in dem der Umsatzsteuersatz auf die Hälfte gesenkt wird.
Völlig umbauen will hingegen die FDP das Steuersystem, die sieben unterschiedlichen Einkommensarten sollen abgeschafft und Ausnahmeregeln abgebaut werden. Gewerbesteuer und Ökosteuer sollen verschwinden, die Kfz-Steuer wird auf die Mineralölsteuer umgelegt. Die Liberalen setzen außerdem auf einen dreistufigen Steuertarif mit 15, 25 und 35 Prozent. Ein populäres Konzept, das auch zur guten Bewertung der FDP beiträgt. Dennoch äußerte Jochen Sigloch in der Sendung Kritik: „Die FDP wird eindeutig zu gut benotet. Die Leute fallen auf diesen plakativen Tarif herein, was wenig Sinn macht. Ein stetig ansteigender Tarif ist genauso einfach. Sie brauchen nur in die Tabelle zu schauen, schon haben Sie das Ergebnis. Im übrigen stehen die Vorschläge zur Gegenfinanzierung aus.“
Die PDS will den Spitzensteuersatz nicht senken, die Banken teilweise verstaatlichen und die Vermögenssteuer wieder einführen. Die Erbschaftssteuer wird höher, eine Luxusgütersteuer von zehn bis 15 Prozent eingeführt.
Wer sichert das Alter?
Am Donnerstag, 5. September um 18:30 Uhr untersucht n-tv die Antworten der Parteien auf die Frage: Wer sichert das Alter? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutiert n-tv-Moderator Lars Brandau gemeinsam mit Rudolf Hickel, Wissenschaftlicher Direktor am PIW-Institut für Wirtschaftsforschung und Meinhard Miegel, Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft in Bonn.
Mittlerweile glauben die meisten jungen Deutschen, dass sie im Alter sowieso nicht mehr auf die staatliche Rente bauen können. Trotz Riester-Reform springt aber auch die private Vorsorge für das Alter nicht an. Die Probleme sind da: Immer weniger arbeitende Menschen müssen immer mehr Rentner versorgen. Doch eine tiefgreifende Reform des Systems hat bisher noch keine Regierung angepackt.
Wird es nun in der kommenden Legislaturperiode eine Partei wagen, eine mutige Rentenreform durchzusetzen? Die SPD beruft sich in ihrem Programm auf die Riesterreform und will die Rente von versicherungsfremden Leistungen befreien. Die CDU hält die Riester- Reform für unzureichend und „notwendige Korrekturen“ durchführen. Dass eine zusätzliche private Vorsorge nötig ist, darüber herrscht weitgehend Einvernehmen. Wie groß dieser Anteil sein soll, ist noch strittig. Die FDP sieht die private Komponente bei 50 Prozent. Damit will die FDP auf längere Sicht weg von den umlagefinanzierten Renten und hin zu einer beitragsfinanzierten Grundsicherung.
Nach dem Willen aller Parteien außer der PDS soll die Lebensarbeitszeit verlängert werden. Anreize zur Frühverrentung und Altersteilzeit sollen abgeschafft oder nur noch bedingt gefördert werden. Die CDU will das tatsächliche Eintrittsalter dem gesetzlichen anpassen. Die FDP will eine Verlängerung auch durch einen früheren Eintritt in die Berufstätigkeit erreichen - etwa durch eine Aussetzung der Wehrpflicht und eine Verkürzung der Berufsbildungs- und Ausbildungszeiten.
In allen Programmen finden sich auch Vorschläge dazu, ob die Rente in Zukunft auch besteuert wird. Die Grünen schlagen vor, die Sozialversicherungsbeiträge von der Steuer zu befreien und eine „konsequente nachgelagerte Besteuerung einzuführen. Einzig die PDS weicht in vielen Punkten von den anderen Parteien ab und will etwa alle Erwerbseinkommen der Versicherungspflicht unterwerfen oder die betriebliche Altersvorsorge zur „vorrangigen Sicherungsform“ machen.
thema2: Aufbau Ost
Aufbau Ost: Arbeitsplätze sind Mangelware
Die Sendung am Donnerstag, den 15. August um 18:30 Uhr zum Thema Aufbau Ost musste wegen der Berichterstattung zur Flutkatastrophe im Osten Deutschlands leider ausfallen. Dennoch sehen sie hier die Beurteilung der Experten und die "Noten" (siehe Link).
Die Probleme des Ostens sind nach wie vor, auch ohne Jahrhundertflut, gravierend. Der wirtschaftliche Aufbau in den neuen Ländern kommt nicht voran. Seit zwei Jahren liegt das Wachstum dort sogar unter dem Niveau der alten Länder. Ergebnis: das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Osten erreicht aktuell nur knapp 62 Prozent des Westniveaus. Dennoch sollen Löhne, Renten und andere Leistungen bald angeglichen werden, doch nicht alle Unternehmen im Osten werden dies überleben. Nach Ansicht der EU-Kommission sind die Spätfolgen der Wiedereinigung zu zwei Dritteln für die gesamtdeutsche Wachstumsschwäche verantwortlich.
Auf dem Arbeitsmarkt stellt sich die Lage dramatisch dar. Das Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) schätzt, dass in diesem Jahr die Zahl der Erwerbstätigen um 96.000 sinkt. Im ersten Arbeitsmarkt wird demnach die Zahl der Arbeitsplätze um 113.000 sinken. Besonders betroffen seien die öffentliche Verwaltung und das Baugewerbe. Die Arbeitslosenquote in den neuen Ländern dürfte weiter steigen und auf dem Höchstwert von rund 18 Prozent verharren. Das Schlusslicht in der Arbeitslosenstatistik ist Sachsen-Anhalt mit einer Quote von 19,8 Prozent.
Im Jahr 2001 wurden staatliche Beschäftigungsprogramme stark zurückgefahren. Das IWH hat errechnet, dass in diesem Jahr aber wieder rund 16.000 Personen oder neun Prozent mehr in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert werden, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Etwa drei Prozent der ostdeutschen Erwerbstätigen werden dann im zweiten Arbeitsmarkt beschäftigt sein.
Die Parteien haben in ihren Wahlprogrammen dem „Aufbau Ost“ lange Kapitel gewidmet, einzig der FDP ist der Osten ganze drei Seiten wert. Die Rede ist viel von regionaler Förderung, der Verzahnung von Forschung und Wirtschaft und der Unterstützung von Gründern. Einig ist man sich offenbar, dass man im Kleinen beginnen muss, um vielleicht in einigen Jahren positive Effekte für Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu erreichen.
Unterschiede gibt es hingegen bei den Vorschlägen zur Lösung der Probleme auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt. SPD, Grüne und PDS wollen die umstrittenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen fortführen, die Union will nur noch ältere Arbeitnehmer in ABM beschäftigen, die FDP mittelfristig ganz auf ABM verzichten.
Nicht einig sind sich die Parteien auch, wie bald die Löhne im Osten auf Westniveau angehoben werden sollen. Im öffentlichen Dienst ist vorgesehen, dass die Gehälter bis 2007 auf Westniveau angehoben werden. Beide große Parteien wollen das auch so durchführen, die CDU/CSU betont aber auch, wie wichtig differenzierte Löhne sind. PDS und Grüne bestehen allerdings auf einem festen Fahrplan zur Lohnangleichung. Dieses Konzept erntete Kritik. Martin Rosenfeld vom Institut für Wirtschafstforschung in Halle (IWH): „Die Lohnanpassung sollte Tarifverträgen und den Betrieben überlassen bleiben, die Politik sollte sich hiervon fernhalten. Höchstens im öffentlichen Dienst könnte die Politik gewisse Signale setzen."
Das alle Parteien die Investitionszulage fortführen wollen, findet die Zustimmung der Experten. Rudolf Hickel: "Die Investitionsförderung darf aber nicht nur bei Sachinvestitionen ansetzen, sondern muss verbunden werden mit der Durchsetzung von qualitativen Produktionskonzepten.“
thema 3: Arbeitsamt-Reform
Wer reformiert das Arbeitsamt?
Am Donnerstag, 22. August um 18:30 Uhr, untersuchte n-tv die Antwort der Parteien auf die Frage: Wer reformiert die Bundesanstalt für Arbeit? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutierte n-tv- Moderator Lars Brandau gemeinsam mit Rudolf Hickel vom PIW Institut für Wirtschaftsforschung und Meinhard Miegel, Leiter des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit steht bei allen Parteien an erster Stelle der Agenda im Wahlkampf. Dabei gibt es erstaunlich viel Gemeinsamkeiten bei allen Parteien, mit Ausnahme der PDS, die in vielen Dingen doch einen Sonderweg einschlägt.
So ist es offensichtlich Konsens, dass Sozial- und Arbeitshilfe gebündelt werden müssen und ein neue Form von sozialer Grundsicherung eingeführt werden soll. Die SPD lehnt allerdings eine Leistungskürzung bislang ab. Bei der CDU ist man sich noch nicht sicher: Späth sagt Ja, Stoiber beharrt auf Nein. Die Vorschläge der „Hartz-Kommission“, die sogar eine Pauschalierung der Arbeitslosenunterstützung vorsehen, bringen immerhin einen ganz neuen Aspekt in die Diskussion.
Die FDP plant die Entkoppelung der sozialen Sicherung vom Arbeitseinkommen. Die Sozialversicherungspflicht wird von einer Versicherungspflicht für eine Grundsicherung abgelöst werden. Alle sozialen Hilfeleistungen werden als Bürgergeld gezahlt. Anreize bei Arbeitsaufnahme müssen eingeführt werden, das Arbeitslosengeld wird nur 12 Monate gezahlt.
Die Arbeitsverwaltung und -vermittlung wollen alle Parteien gründlich reformieren. Private Job-Agenturen sollen es richten, die zum Teil in Konkurrenz zu Arbeitsämtern operieren sollen. Die Landesarbeitsämter sollen aufgelöst werden. So soll die Vermittlungsdauer verkürzt und der mäßige Erfolg bei der Vermittung von neuen Stellen verbessert werden.
Doch so einfach geht es offenbar nicht. Meinhard Miegel: „Ich halte nichts davon die Bundesanstalt im Ergebnis durch die Auflösung der Landesarbeitsämter aufzuwerten. Weil das Arbeitsmarktproblem in hohem Maße ein regionales Problem ist und die Unterschiede zwischen den Regionen beträchtlich sind, hätte ich umgekehrt dafür plädiert, die Landesarbeitsämter zu stärken.“
Auch bei den Grünen geht es um eine effektivere Arbeitsvermittlung und wird über die Wahlfreiheit zwischen staatlichen und privaten Vermittlern nachgedacht. Den zukünftigen Mitarbeitern des Arbeitsamtes soll der Beamtenstatus aberkannt werden.
CDU, SPD und Grüne wollen die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen im Osten fortsetzen, die PDS hält sie gar für unverzichtbar. Die FDP will die ABM deutlich einschränken und schlechter bezahlen.
thema 4: STEUERN
Steuerpolitik: Prozente und Paragrafen
Am Donnerstag, 29. August um 18:30 Uhr untersuchte n-tv die Antworten der Parteien auf die Frage: Wer schafft ein verständliches Steuersystem? Welche Vorschläge wirklich sinnvoll sind, diskutierte n-tv-Moderator Lars Brandau mit Rudolf Hickel, Wissenschaftlicher Direktor am PIW-Institut für Wirtschaftsforschung, und Jochen Sigloch, Steuerexperte von der Universität Bayreuth.
In der Steuerpolitik stehen sich die Parteien näher, als sie nach außen hin zugeben. Da bei ist es letztlich unerheblich, ob der Spitzsteuersatz 35 Prozent (wie bei der FDP) oder 40 Prozent (wie bei der CDU) oder 42 Prozent (wie bei SPD und Grünen) beträgt. Wesentlicher wird sein, wer es schafft das Steuersystem so umzubauen, dass Ausnahmen wegfallen und die Belastung der Bürger insgesamt sinkt.
Alle Vorschläge, die eine Senkung der Einkommenssteuersätze beinhalten, stehen sowieso unter dem "Finanzierungsvorbehalt". Da sich die Bundesregierung an das Maastrichter Defizitkriterium halten muss, muss sie das Geld, was sie durch Steuersenkungen verliert, an anderer Stelle wieder hereinholen. Darüber findet sich aber nicht viel in den Parteiprogrammen.
Aussagen dazu, wo und wie gespart werden soll, erschöpfen sich zu allgemeinen Willenserklärungen zum Subventionsabbau. Dem Kohlebergbau geht es nach dem Willen der FDP und den Grünen an den Kragen, die Grünen wollen zusätzlich die Landwirtschaft mehr zur Kasse bitten und die Entfernungspauschale abbauen.
Die SPD will die Ökosteuer nach 2003 nicht weiter erhöhen und wie vorgesehen die Reform der Einkommenssteuer bis 2005 umsetzen. Dadurch wird der Eingangssteuersatz bei 15, und der Spitzensteuersatz bei 42 Prozent liegen. Rudolf Hickel kritisierte in der Sendung die Ökosteuer-Pläne: „Wenn man die Ökosteuer ernst nimmt, braucht übrigens auch die Wirtschaft eine mittelfristige Planbarkeit. Das Projekt einfach abzubrechen, wäre eine Katastrophe. Es muss fortgeführt werden, mit einigen Änderungen. Jetzt einfach auszusteigen, denunziert die gesamte Idee der Ökosteuer.“
Die CDU/CSU will die Ökosteuer aussetzen und mittelfristig durch eine Schadstoffabgabe ersetzen. Sie schlägt einen Eingangssteuersatz von 15 Prozent vor und will den Höchststeuersatz bis 2006 auf 40 Prozent bei einem flachen linearen Tarifverlauf senken. Steuersubventionen und Ausnahmen werden gestrichen.
Die Grünen wollen die Steuerreform weiter umsetzen und Steuervergünstigungen abbauen. Der Grundfreibetrag wird 7664 Euro angehoben und kleinere und mittlere Einkommen entlastet. Im Gegensatz zu den anderen Parteien wollen die Grünen die Ökosteuer weiterentwickeln, die Lohnnebenkosten weiter senken und öffentliche Verkehrsmittel subventionieren, in dem der Umsatzsteuersatz auf die Hälfte gesenkt wird.
Völlig umbauen will hingegen die FDP das Steuersystem, die sieben unterschiedlichen Einkommensarten sollen abgeschafft und Ausnahmeregeln abgebaut werden. Gewerbesteuer und Ökosteuer sollen verschwinden, die Kfz-Steuer wird auf die Mineralölsteuer umgelegt. Die Liberalen setzen außerdem auf einen dreistufigen Steuertarif mit 15, 25 und 35 Prozent. Ein populäres Konzept, das auch zur guten Bewertung der FDP beiträgt. Dennoch äußerte Jochen Sigloch in der Sendung Kritik: „Die FDP wird eindeutig zu gut benotet. Die Leute fallen auf diesen plakativen Tarif herein, was wenig Sinn macht. Ein stetig ansteigender Tarif ist genauso einfach. Sie brauchen nur in die Tabelle zu schauen, schon haben Sie das Ergebnis. Im übrigen stehen die Vorschläge zur Gegenfinanzierung aus.“
Die PDS will den Spitzensteuersatz nicht senken, die Banken teilweise verstaatlichen und die Vermögenssteuer wieder einführen. Die Erbschaftssteuer wird höher, eine Luxusgütersteuer von zehn bis 15 Prozent eingeführt.
Text zur Anzeige gekürzt. Gesamten Beitrag anzeigen »