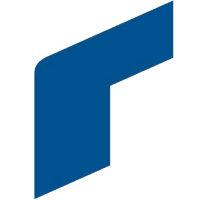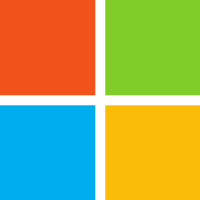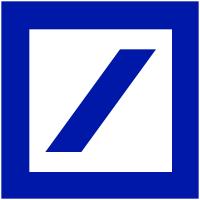Konjunktur: Die USA treiben in die nächste Krise
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt spitzt sich zu, die amerikanische Wirtschaft leidet, hinzu kommen ein Rekorddefizit und eine Rekordverschuldung: Der Druck auf US-Präsident Barack Obama ist groß – und wird immer größer. Ob Politiker oder Notenbanker – alle Beteiligten streiten, wie der Konjunktur geholfen werden kann. Den Demokraten wird langsam mulmig.
von Matthias Eberle und Markus Ziener
NEW YORK/WASHINGTON. Der Präsident versuchte es am Wochenende mit einem Appell: Die Politiker müssten parteiübergreifend alle wahltaktischen Spielereien hinter sich lassen und zusammenkommen, um der wirtschaftlichen Erholung einen neuen Schub zu geben. Die recht verzweifelten Worte zeigen: Barack Obama steht unter Druck. Denn um die amerikanische Wirtschaft steht es schlecht.
Der am Freitag veröffentlichte Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Juli fiel erneut schwach aus. Weitere 131 000 Arbeitsplätze gingen verloren. Nun steigt der Druck auf die US-Regierung und die Notenbank Federal Reserve (Fed), mit weiteren Konjunkturhilfen gegenzusteuern. Wie genau eine solche Unterstützung für die Konjunktur und die etwa 15 Millionen Arbeitslosen aussehen kann, darüber streiten allerdings alle Beteiligten in den USA. Obama müsse einsehen, dass seine auf Konjunkturprogramme ausgerichtete Politik nicht funktioniere, sagte der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, John Boehner.
Weitere Konjunkturprogramme, wie sie etwa die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, vorschlägt, sind damit politisch kaum durchsetzbar. Warum sollten neue, kleinere Stimuli bewirken, was schon dem 787 Mrd. Dollar teuren Konjunkturprogramm aus dem vergangenen Jahr nicht gelang? Dabei war Obama politisch bereits an die Grenze dessen gegangen, was im Kongress durchsetzbar war.
Inzwischen sind viele dieser Milliarden aufgebraucht, auch andere positive Konjunktureffekte wie der Lagerzyklus im Unternehmenssektor beginnen sich abzuschwächen. Jetzt müsste dringend der Verbraucher in die Läden zurückkommen und den für die US-Konjunktur entscheidenden Konsum anschieben, aber die privaten Finanzen und der anhaltend desolate Jobmarkt lassen das nicht zu.
Die Arbeitslosenquote verharrt nach offiziellen Angaben bei 9,5 Prozent, die breiter gefasste Unterbeschäftigtenrate liegt gar bei 16,5 Prozent. Sie zählt auch jene Menschen hinzu, die wegen Entmutigung entweder gar nicht mehr auf Jobsuche sind oder nur Teilzeitbeschäftigung finden. Annähernd sieben Millionen Menschen sind in den USA bereits seit einem halben Jahr und länger arbeitslos – mit entsprechend sinkenden Chancen, überhaupt noch mal einen Job finden. Obwohl die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2010 nach amtlichen Zahlen noch mit 2,4 Prozent (annualisiert) gewachsen ist, fühlen sich weite Teile des amerikanischen Volkes weiter in der Rezession.
Drei Monate vor den Kongresswahlen sind die regierenden Demokraten damit in einer bedrohlichen Lage. Die bisherigen wirtschaftlichen Maßnahmen der Obama-Administration lassen sich angesichts hoher Arbeitslosigkeit und eines rasant wachsenden Defizits schlecht als Erfolg verkaufen. „Es ist Zeit, ein neues Wirtschaftsmodell auszuprobieren“, schrieb das „Wall Street Journal“ am Wochenende. Nur welches?
Christina Romer, die vergangene Woche ihren Rücktritt als Vorsitzende der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten bekannt gab, hatte im Januar 2009 eine Arbeitslosenrate von unter acht Prozent prophezeit. Möglich sei dies durch das Konjunkturpaket, das die Obama-Regierung gerade schnürte, begründete sie ihre Prognose. Inzwischen bereut Romer diese Einschätzung. Sie wünschte, sie könne dies zurücknehmen, sagte sie am Freitag. Die Republikaner nutzen Romers Fehlprognose längst als Steilvorlage, um weitere Konjunkturmaßnahmen zu blockieren. Sie argumentieren, dass mit dem staatlichen Stimulusprogramm nur Geld verschwendet werde. Die Billigung weiterer Mittel sei deshalb der falsche Weg.
Auch einigen Demokraten wird es angesichts galoppierender Staatsschulden mulmig. Ein „großer zweiter Stimulus“ würde nur die Unsicherheit erhöhen und das Vertrauen in die USA unterminieren, warnt der frühere Finanzminister der Clinton-Regierung, Robert Rubin. Man müsse sich damit abfinden, dass Amerika vor einer unruhigen Periode mit schwachem Wachstum stehe, sagte Rubin am Wochenende in einem CNN-Interview. [Na das hört man als US-Bär doch gern ;-)]
Die Ratlosigkeit, wie die US-Konjunktur aufs Neue angeschoben werden könnte, wächst damit. Die einzige Hoffnung scheint derzeit die US-Notenbank Fed, die bereits morgen den Ankauf weiterer Hypotheken beschließen könnte, um der Wirtschaft frisches Geld zuzuführen. Dabei hatten die Währungshüter erst vor vier Monaten beschlossen, das gigantische Anleihekaufprogramm im Volumen von 1,5 Billionen Dollar schrittweise auslaufen zu lassen.
Rekorddefizit, Rekordverschuldung und eine rekordverdächtige Staatsquote: Praktisch seit Übernahme der Amtsgeschäfte im Weißen Haus fühlen sich die Demokraten von der republikanischen Opposition wegen ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik in die Ecke gedrängt.
Doch drei Monate vor den Kongresswahlen suchen die Demokraten geradezu den Streit über ein hochexplosives Thema – die Höhe der Steuern. Mit einer Debatte darüber, ob die noch unter Präsident George W. Bush beschlossenen Steuersenkungen beibehalten werden sollen, will die Regierungspartei aus der Defensive kommen.
Dabei machen sich die Demokraten die Argumente der Republikaner zu eigen. Ohne Rückführung der Steuern auf ihr früheres Niveau werde der Abbau des Defizits nicht gelingen, sagen sie. Erst im Februar hatte das Weiße Haus berechnen lassen, dass die Beibehaltung der Niedrigsteuer 33,5 Mrd. Dollar kostet – genau so viel kostet es, geplante Hilfen für arbeitslose Amerikaner zu finanzieren. Das bringt die Republikaner in ein Dilemma: Sie fordern einerseits vehement den Abbau der aufgeblähten Defizite, können aber andererseits schlecht für Steuererhöhungen plädieren.
Also verlaufen die Linien der Debatte quer durch beide Lager. Keiner weiß im Moment die wirtschaftliche Lage sicher einzuschätzen. Wie weit sich die Volkswirtschaft bereits wieder erholt hat, ist mehr eine Frage des Glaubens denn des Wissens.
Sicher ist nur, dass das aufs Jahr hochgerechnete Wachstum von 2,4 Prozent im zweiten Quartal nicht für eine Entlastung auf dem Arbeitsmarkt ausgereicht hat, schon gar nicht, wenn man zu den offiziellen 9,5 Prozent Arbeitslosen noch jene bis zu zehn Prozent hinzuaddiert, die bereits aus der Statistik herausgefallen sind. Gestritten wird deshalb darüber, wie mehr Wachstum zu erzielen ist: Über niedrigere Steuern oder über weitere staatliche Konjunkturimpulse, etwa durch direkte Hilfen für Arbeitslose.
Ein Beispiel für den Widerspruch ist der unabhängige Ökonom Mark Zandi. Der ist zwar einerseits gegen Steuererhöhungen und wird in diesem Punkt auch gerne von den Republikanern als Kronzeuge bemüht. Doch gleichzeitig lobt er auch das von Obamas Regierung umgesetzte Konjunkturprogramm mit einem Umfang von 787 Mrd. Dollar als „sehr signifikant“. Diesen wichtigen Aspekt der Zandi-Expertise unterschlagen die Republikaner jedoch gerne, da sie sich politisch auf die Ablehnung der massiven Staatsintervention festgelegt haben.
Umgekehrt bemühen sich die Demokraten, Zweifel an der Weisheit einer Steuererhöhung herunterzuspielen. Christina Romer, die Vorsitzende des ökonomischen Beraterkreises im Weißen Haus, die vor kurzem ihren Rücktritt angekündigt hat, publizierte vor kurzem ein Papier, in dem es heißt, Steuererhöhungen führten zu einer wirtschaftlichen Schrumpfung. [falsche Partei?? A.L.] Das Interesse an der Verbreitung dieser Einschätzung war auf Seiten der Regierung begrenzt.
Noch hat sich die Regierung nicht festgelegt, ob sie die Steuersenkungen zurücknehmen will. Spätestens nach den Kongresswahlen im November muss sie sich jedoch entscheiden. Denn zum Jahresende laufen die Steuernachlässe aus.
www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/...oc_page=0;printpage