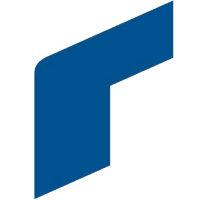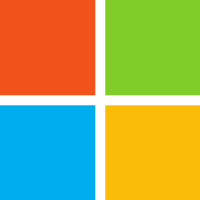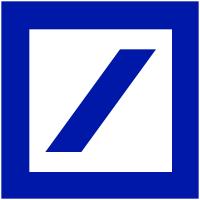Keine Woche vergeht mehr ohne dramatische Abstürze an den Aktienmärkten. Und noch immer glauben die Auguren, dass die Wertvernichtung nicht aufs reale Wirtschaftswachstum durchschlägt. Doch die Alarmsignale einer tief greifenden Krise mehren sich.
"Hier herrscht Panik, blanke Panik", rief ein Reporter des Nachrichtensenders N-tv am vergangenen Mittwoch in sein Mikrofon. Er hatte die hektische Stimme eines Kriegsreporters, der ganz vorn an der Front steht - direkt auf dem Parkett der Frankfurter Börse.

Zeugen des Absturzes: AOL-Händler an der Börse von Chicago sehen den Kurs des Konzerns fallen
Zwei Tage zuvor hatte der amerikanische Telekommunikationsriese WorldCom Konkurs angemeldet. Durch die bislang größte Pleite der Wirtschaftsgeschichte wurden 120 Milliarden Dollar vernichtet. Aus den USA wehte zudem das Gerücht heran, die US-Notenbank könne zu einer Notsitzung zusammenkommen. In Deutschland sorgten Hausdurchsuchungen bei dem Finanzdienstleister MLP ebenso für Aufruhr wie angebliche Preisabsprachen bei Versicherungen, die wie Banken prompt in den allgemeinen Abwärtsstrudel gerieten. Aktienhändler sprachen von einem "mittleren Blutbad".
An einem solchen Tag kann es angeraten sein, mit Experten wie Eckhardt Wohlers zu reden. Der Konjunkturforscher beim Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) erklärt mit ruhiger Stimme, der Crash an den Börsen, der in Deutschland allein in der vergangenen Woche Kapital in Höhe von über 50 Milliarden Euro verpuffen ließ, werde für die Wirtschaftsentwicklung "keine großen Folgen" haben. Wohlers fürchtet keine Rezession. Allenfalls werde sich der Aufschwung, der für das zweite Halbjahr erwartet wurde, etwas verschieben.
In der Zwischenzeit brachen die Aktien der HypoVereinsbank um bis zu 20 Prozent ein, die der Commerzbank um über 13 und die der Deutschen Bank um fast 10. "Atmen Sie erst einmal durch", riet der N-tv-Moderator seinen Zuschauern, "wir sind gleich wieder für Sie da." Nach der Werbepause ging es weiter - abwärts.
Der Dax, der im März des Jahres 2000 noch bei über 8000 Punkten lag, notierte am vergangenen Freitag nur noch bei 3580. Der US-Index Dow Jones schmierte im gleichen Zeitraum von 11 100 auf gut 8000 Punkte ab. Und all diese Beben sollen keine Auswirkungen auf Wachstum, Investitionen und Arbeitsplätze haben?
In solchen Momenten kann es auch beruhigend wirken, mit Wolfgang Wiegard zu reden, Chef jenes Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sich "Die fünf Weisen" nennen lässt. "Die Auswirkungen der Aktienmärkte auf die reale Wirtschaft schätze ich gegenwärtig eher gering ein", sagt Wiegard. Die Gefahr, dass der Kurssturz gar eine neue Rezession einleiten könnte, sieht er "zurzeit ganz und gar nicht".

Ratlosigkeit: Selten hat der Handel an den Börsen solche Ausschläge verzeichnet wie vergangene Woche
Seine Erklärung wie auch die vieler seiner Kollegen: Die Entwicklung an der Börse habe sich von der wirtschaftlichen Realität abgekoppelt. Während die Aktienkurse noch abstürzten, vor allem weil die Anleger nach den Skandalen um Enron und Co. das Vertrauen in Bilanzen und Unternehmensführer verloren haben, gebe es genügend Aufschwungsignale wie das stabile Wachstum in den USA. Auf Dauer setze sich die reale Wirtschaft gegen die kurzfristigen Trends der Börsen durch.
Doch mit jedem Tag, an dem die Kurse weiter sinken, wachsen die Zweifel, ob Konjunkturforscher wie Wohlers und Wiegard mit ihren Analysen wirklich richtig liegen. Denn es scheint keineswegs zwingend, dass die bislang gute US-Konjunktur dafür sorgt, die Unternehmensgewinne und damit auch die Börsenkurse wieder nach oben zu ziehen. Möglich ist derzeit durchaus auch die umgekehrte Entwicklung: Die einstürzenden Börsenkurse könnten die gesamte Ökonomie mit in die Tiefe reißen.
Eine schwer zu durchbrechende Abwärtsspirale, die Industrie wie Kleinsparer, Arbeitsplätze wie Altersversorgung gleichermaßen bedroht? Ein Horrorszenario? Gewiss. Aber es mehren sich die Alarmsignale.
Am vergangenen Donnerstag legte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung einen wichtigen Frühindikator für die Konjunkturentwicklung vor, den so genannten Geschäftsklima-Index. Dafür befragen die Forscher 7000 Unternehmen nach ihren Geschäftserwartungen. Jüngstes Ergebnis: Die Firmen sind im Juli deutlich pessimistischer geworden. Wenn es im August so weitergeht, sagt Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, müsse man davon ausgehen, dass der viel beschworene Aufschwung stockt.
Für Finanzminister Hans Eichel steht die Hauptursache fest: Die starken Kursverluste an den Weltbörsen, die ein "Gefährdungsfaktor" für die Konjunktur geworden seien - da solle man "gar nicht herumreden".
Die Folgen der Börsenbaisse lassen sich zuallererst bei den Banken beobachten. Und bei denen könnte es düsterer kaum aussehen. Albrecht Schmidt, Vorstandsvorsitzender der HypoVereinsbank, orakelt: "Wir bewegen uns im schwersten Bankenjahr seit Kriegsende." Die Kreditinstitute reagieren nach bekanntem Muster: Sie streichen Arbeitsplätze. Allein die vier privaten Großbanken haben den Abbau von 35.000 Jobs angekündigt.
Besonders stark auf Geschäfte rund um die Börse hat die Deutsche Bank gesetzt. Die Kreditvergabe an den Mittelstand hat sie zurückgefahren, weil das Geschäft als wenig lukrativ gilt. Stattdessen wurden Unternehmensführer wie WorldCom-Gründer Bernie Ebbers oder der französische Vivendi-Chef Jean-Marie Messier mit großzügigen Kreditlinien hofiert.
Die Bank benutzte die Kredite wie ein Eintrittsgeld, um mit solchen Konzernen dann ins lukrative Geschäft der Unternehmensübernahmen oder der Emission von Anleihen zu kommen. Doch der Preis ist, wie die Deutsche Bank jetzt zu spüren bekommt, viel höher als erwartet. Sie muss ihre Risikovorsorge für Kredite, die möglicherweise nie zurückgezahlt werden, um mehrere hundert Millionen Euro aufstocken. Allein bei WorldCom war Deutschlands größte Bank mit 241 Millionen Dollar engagiert.
Die Krise der Finanzindustrie wirft dunkle Schatten auch auf die übrige Wirtschaft und gefährdet Arbeitsplätze in ganz anderen Industriezweigen wie dem Maschinenbau oder der Software-Industrie. Unternehmer, die auf frisches Geld zum Ausbau ihres Geschäfts angewiesen sind, geraten immer weiter ins Trudeln. "Der Kapitalmarkt ist tot", sagt ein Investmentbanker.
Bis zu 60 Neuemissionen sollte es nach einer Prognose von Sal. Oppenheim dieses Jahr in Deutschland geben. Den Sprung aufs Parkett geschafft haben bislang aber nur fünf Firmen. Etliche andere Unternehmen wie beispielsweise der Weilheimer Solarzellenhersteller SES 21 mussten ihren Börsengang kurzfristig wieder absagen.
Die Börse fällt als Risikokapitalgeber also bis auf weiteres aus. Gleichzeitig aber kappen viele Banken die Kreditlinien. Der Stuttgarter Wirtschaftsanwalt Brun-Hagen Hennerkes, der im Aufsichtsrat größerer Mittelständler sitzt, diagnostiziert: "Viele Hausbanken lassen ihre Mittelstandskunden im Regen stehen."
Schwer getroffen werden von der Börsenbaisse aber auch die Lebensversicherungsgesellschaften. Sie sind gesetzlich gezwungen, ihren Kunden eine Verzinsung von 3,25 Prozent zu garantieren. In den Jahren des Aktienbooms haben auch deutsche Versicherungen immer mehr Kapital in Aktien angelegt. Bei fallenden Kursen müssen sie jetzt verkaufen, um überhaupt die Garantieverzinsung zahlen zu können. Dies war, wie Börsenhändler berichten, einer der rationalen Gründe, warum die Kurse jüngst so stark absackten. Hinzu kommt ein fast noch wichtigerer Faktor: die Furcht.
Ein Großteil des Geschehens an den Börsen lässt sich nur noch mit dem Instrumentarium der Psychologie erklären. Da meldete Siemens am vergangenen Mittwoch hervorragende Quartalszahlen, hat schon in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs mehr verdient, als der Konzern für das gesamte Jahr prognostizierte - und wie reagierte der Kurs? Er sackte teilweise um mehr als neun Prozent ab.
Aktienhändler begründeten das Debakel damit, dass bei Siemens der Auftragseingang fürs vierte Quartal gesunken sei. Psychologen nennen derlei selektive Wahrnehmung.
Positive Nachrichten werden nicht mehr zur Kenntnis genommen. Jedes Gerücht aber, das einer Bank gestiegenen Abschreibungsbedarf unterstellt oder einem Unternehmen geschönte Bilanzen, wird gierig aufgegriffen und führt zu Einbrüchen nicht nur bei den vermeintlich betroffenen Firmen. Abgestraft werden meist auch andere Unternehmen, die in der gleichen Branche aktiv sind. Als der US-Pharmakonzern Merck wegen Bilanztricks ins Gerede kam, rutschte der Kurs des gleichnamigen deutschen Unternehmens im Gleichklang ab - obwohl die beiden Konzerne keinerlei Berührungspunkte haben.
Und wenn sich später herausstellt, dass ein Gerücht nur ein Gerücht war, steigen die Kurse selten auf das alte Niveau. Es könnte ja doch etwas dran sein.
Das blinde Vertrauen, das die meisten Anleger während des Booms Ende der neunziger Jahre in Bilanzen und Prognosen der Konzerne hatten, hat sich ins Gegenteil verkehrt: ein ebenso blindes Misstrauen. Entsprechend heftig sind die Kursausschläge an den Börsen, an denen vor allem ein Wort Konjunktur hat: Angst.
Nur eine Spezies von Wirtschaftsprofis lässt sich davon nicht anstecken, die der Konjunkturforscher. Die Auguren verweisen gebetsmühlenartig darauf, dass der Börsencrash in Deutschland schon deshalb keine großen Auswirkungen haben dürfte, weil hier zu Lande nur gut 18 Prozent der Bevölkerung Aktien besitzen. Fallende Kurse dürften kaum zu einer sinkenden Konsumnachfrage führen. Ganz anders in den USA, wo die Aktienkultur viel tiefer verwurzelt sei - und nun Millionen Senioren um die Altersvorsorge ihrer Pensionsfonds fürchten.
Aber was geschieht, wenn auch die kauffreudigsten Verbraucher der Welt, die US-Amerikaner, ihr Geld lieber sparen? Dann, so gestehen auch Konjunkturforscher, drohe tatsächlich Gefahr, auch für Europa.
Das Szenario ist schnell skizziert: Der Kurs des Dollar würde stärker sinken, der des Euro steigen. Deutsche Maschinenbauer, Chemiefirmen und Autohersteller könnten kaum noch so viel in die USA exportieren. Und weil diese Ausfuhren bislang eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft sind, drohten dann auch hier Rezession, noch mehr Pleiten und ein noch mieseres Konsumklima, das wiederum die Aktienmärkte mit sich reißen würde.
Gegensteuern könnten vor allem Wirtschaftspolitiker und Notenbanken. Sie können, ganz traditionell, die Leitzinsen senken. Aber auch völlig ungewöhnliche Vorschläge werden diskutiert. Die Schweizer Investmentbank Credit Suisse First Boston präsentiert in einer Studie die Idee, dass die Notenbanken an der Börse Aktien kaufen könnten. Der Vorschlag klingt abenteuerlich. Aber er zeigt, wie dramatisch die Entwicklung von einigen Experten mittlerweile eingeschätzt wird.
Angesichts solcher Äußerungen fällt es zunehmend schwer, sich von den eher unspektakulären Analysen der Wirtschaftswissenschaftler beruhigen zu lassen. Nur wenn die Kurse noch kräftig weiter absacken und dauerhaft unten bleiben, sieht Konjunkturforscher Wohlers vom HWWA echte Gefahren.
Und der oberste Wirtschaftsweise, Professor Wiegard, ist weiterhin überzeugt: "Der Aufschwung kommt, wenn auch vielleicht etwas später als erwartet."
spiegel.de
Die Weltwirtschaft klettert mühsam aus dem Tal, doch die Börse geht ihre eigenen Wege. Die Indizes haben sich vom Konjunkturverlauf gelöst und drücken nun auf das Vertrauen der Verbraucher. Wie groß ist die Gefahr, dass die Wall Street nun auch die "Real Street" mit sich reißt?

Einst eilte die Börse der Konjunktur voraus. Nun droht sie die Wirtschaft zu lähmen.
Damals, in den alten Zeiten, gab es noch Anhaltspunkte. Da reagierte die Börse noch auf Veränderungen der globalen Konjunktur. Wie ein Seismograf schlug sie auf wichtige Frühindikatoren an und eilte der Entwicklung der Wirtschaft um sechs bis acht Monate voraus. Auch damals ließen sich keine Kurse vorhersagen, doch auf lange Sicht verliefen die Indizes zeitversetzt, aber im Einklang mit der Konjunkturkurve. In den alten Zeiten.
Inzwischen ist die Welt komplizierter geworden. Nach Ansicht der Volkswirte hat die Konjunktur in den USA bereits vor sieben Monaten ihre Talsohle durchschritten, doch die Indizes markieren fast jede Woche neue Tiefs. Die Wirtschaft scheint sich langsam zu berappeln, aber die Finanzmärkte marschieren konsequent in die andere Richtung. Von Erholung keine Spur: Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Börsen in einem vergleichbar robusten Konjunkturumfeld so schwach wie heute, bemerken die Volkswirte von Goldman Sachs. Bilanzskandale und die tiefe Verunsicherung der Aktionäre sorgen dafür, dass Auftragseingänge und Wirtschaftswachstum beinahe ungehört verhallen.
Der Double Dip droht
Das Kursbarometer an der Wall Street hat sich nicht nur von der "Real Street" gelöst – nun droht das Pendel auch auf die reale Wirtschaftsentwicklung zurückzuschlagen.
Der Aktiencrash könnte die zaghafte Konjunkturerholung wieder ersticken: Nach Ansicht von Stephen Roach, Chefvolkswirt bei Morgan Stanley, droht durch die extrem schwachen Märkte ein "double dip", ein Rückschlag in die Rezession.
Selbst der bedächtige Bundesbank-Präsident Ernst Welteke sorgt sich darüber, dass sich "die Unsicherheiten an den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft auswirken". Die Baisse hat enormes Kapital vernichtet, Löcher in Konzernportfolios und Privatschatullen gerissen und für Unsicherheit bei Firmenchefs wie bei Verbrauchern gesorgt. Einiges spricht dafür, dass die Börsenkurve nun auch die Konjunkturkurve erneut nach unten drückt.
Konsum gerät ins Wanken
Mit Bangen blicken Börsianer auf den Verbraucher in den USA. Bislang hat dieser kräftig weiter eingekauft, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Verluste in den Depots wieder ausgeglichen sind. Die niedrigen Zinsen haben die Konsumlust auch nach den Attentaten im September stimuliert: Viele US-Bürger schuldeten ihr Darlehen für das Haus auf einen niedrigeren Zinssatz um und gingen mit dem gesparten Geld erneut auf Einkaufstour. Die günstigen Finanzierungs- und teilweise Nullzins-Angebote der Auto- und Konsumartikelhersteller waren ja auch verlockend. Zusätzlich floss viel ausländisches Kapital ins Land, was das Leben auf Pump erleichterte.
Doch mit den US-Bilanzskandalen ebbt dieser Geldstrom ab, und das Vertrauen der Amerikaner, das beste Finanzsystem der Welt werde alles richten, ist angeknackst. Hinzu kommt die Sorge, auf Grund des Streichkonzerts der Konzerne bald selbst ohne Job zu sein, und die tiefe Enttäuschung beim Blick auf das eigene Depot. Das Vermögen der privaten Haushalte in den USA ist seit März 2000 um rund 4000 Milliarden Dollar geschrumpft – nach Schätzungen der US-Notenbank könnte dies eine Konsumeinschränkung von 180 Milliarden Dollar bedeuten, wenn die Verbraucher aus der Geldvernichtung Konsequenzen ziehen und das Sparen entdecken.
Zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der USA entfallen auf den privaten Verbrauch und der US-Einzelhandel verbuchte zuletzt bereits leicht rückläufige Umsätze, und das Vertrauen der US-Verbraucher ist im Juli auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Hält dieser Trend an, dürften die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA hinfällig sein.
Geschäftsklima in Deutschland abgekühlt
Der Wertverlust der Aktien schmälert auch die Pensionen der US-Rentner. Aktien spielen in der privaten Altersvorsorge in den USA eine wichtige Rolle, und in vielen US-Pensionsfonds sind Aktien gegenüber Rentenpapieren viel stärker gewichtet als in vergleichbaren europäischen Fonds. Neben den Alltagsausgaben sollten häufig auch die Schulden aus den Gewinnen der Aktienfonds abbezahlt werden. Nun müssen viele Ruheständler knapper kalkulieren.
In Deutschland gibt es nicht so viele Aktiensparer wie in den USA, so dass ein weiterer Kursverfall nicht ganz so stark auf privates Vermögen und Konsum durchschlagen dürfte. Nur etwa jeder fünfte Deutsche hält Wertpapiere, während in den USA Aktien bereits ein fester Bestandteil der privaten Altersvorsorge sind. Dennoch hat der Kursrutsch in den Jahren 2000 und 2001 auch hierzulande rund 160 Milliarden Euro vernichtet, und der private Konsum ist mit 50 Prozent des Bruttosozialproduktes die entscheidende Stütze der Wirtschaft.
Die Teuro-Diskussion und wachsende Sorge um den Arbeitsplatz haben dazu geführt, dass die Konsumenten in Deutschland bereits seit Frühjahr deutlich zurückhaltender sind als in den USA: Einzelhändler beklagen einen "Käuferstreik". Entsprechend schwach fiel auch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli aus. "Der Konsum ist noch nicht in Schwung gekommen, und die Unternehmen halten sich nach wie vor zurück", sagt Ifo-Chefökonom Gernot Nerb. "Damit bringen die Triebkräfte der Konjunktur noch nicht das, was man von ihnen erwartet."
Teure Kredite, zaghafte Investitionen
Unternehmen haben ihre Investitionen zurückgefahren, da ihre Umsatz- und Gewinnprognosen nur noch auf tönernen Füßen stehen. Gleichzeitig wird es für sie schwieriger, sich für neue Projekte Geld zu beschaffen: Ein Börsengang oder eine Kapitalerhöhung kommt im aktuell schwachen Marktumfeld kaum in Frage. Auch die Banken stellen höhere Hürden auf: Die Kredite werden teurer, da die Finanzinstitute auf Grund der zahlreichen Firmenpleiten höhere Rückstellungen bilden müssen. Dies drückt besonders den Mittelstand.
Falls die Anleger ihr Geld weiter vom Kapitalmarkt abziehen, sinkt zudem das Eigenkapital der Big Player im Vergleich zu ihren Schulden – Herabstufungen der Ratingagenturen und teurere Kredite sind die Folge. "In vielen Unternehmen sind Unternehmen eigentlich überfällig", sagt Ifo-Volkswirt Nerb. Doch bei einer weiteren Verknappung von Kapital werden die Finanzierungsbedingungen immer schwieriger. Für die dringend benötigten Investitionen ist dies Gift.
Folgen der fetten Jahre – Gespenst Japan geht um
Besonders die Wachstumsunternehmen leiden noch heute unter den Folgen der fetten Börsenjahre seit Mitte der neunziger Jahre. Umsatz- und Gewinnerwartungen schienen keine Grenzen zu kennen, die Märkte erwarteten pro Quartal abenteuerliche Wachstumsraten.
In diesem Wachstumsrausch haben viele Firmen riesige Überkapazitäten geschaffen, die zum Teil bis heute noch nicht abgebaut sind. Ein großes Güterangebot stößt auf geringe Nachfrage. Dies sorgt für einen anhaltenden Preisverfall. Schon geht die Angst vor japanischen Verhältnissen um: Dort war die Spekulationsblase Ende der achtziger Jahre geplatzt, und das Land hat sich bis heute nicht erholt.
Experten betonen jedoch, dass die US-Notenbank durch ihre aggressiven Zinssenkungen die richtige Abwehrstrategie gewählt hat. Durch eine frühere, stimulierende Geldpolitik hätte die Deflation in Japan vielleicht vermieden werden können, so eine Studie der Fed. Allerdings sind auch in den USA die Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. Sollten die Aktienmärkte weiter einbrechen, hat auch die Notenbank kaum noch Spielraum, mit Zinssenkungen zu reagieren.
Nach Ansicht von Marktbeobachtern könnte selbst eine weitere Zinssenkung in der allgemeinen Nervosität verpuffen – und dann bleibt kaum noch Luft nach unten. Die Europäische Zentralbank (EZB) nimmt in ihren Zinsentscheidungen traditionsgemäß weniger Rücksicht auf die Kapitalmärkte als die US-Notenbank und achtet stärker auf Inflationsrisiken. Volkswirte befürchten, eine Zinserhöhung der EZB im Herbst könnte den ohnehin stotternden Konjunkturmotor drosseln.
Euro in dünner Höhenluft
Die Nervosität an der Wall Street und der Vertrauensverlust gegenüber Corporate America bewegen viele Investoren dazu, von Dollar auf Euro umzuschichten. Der Aufschwung des Euro, der zum Wochenende erneut über der Dollar-Parität notierte, vollzieht sich jedoch in einem volkswirtschaftlich eher ungesunden Tempo.
Falls Herdentrieb und "irrational exuberance" der Anleger die Gemeinschaftswährung weiter nach oben treiben, sieht die europäische Exportwirtschaft schweren Zeiten entgegen. Nach Berechnungen der Investmentbank Morgan Stanley würde ein Euro-Anstieg auf 1,15 Dollar die Exporte der europäischen Unternehmen um sechs Prozent verringern.
Doch nach jeder "irrationalen Übertreibung" folgt auch wieder eine Beruhigung, argumentieren Optimisten. Ebenso wie in den Boomjahren 1999/2000 die Risiken ignoriert worden seien, würden jetzt trotz vergleichsweise robuster Konjunktur die Gefahren überschätzt. Zu diesen Optimisten zählt auch Notenbankchef Alan Greenspan: Die Konjunkturentwicklung sei auf dem richtigen Weg und im nächsten Jahr sei wieder mit einem Wirtschaftswachstum von rund 3,75 Prozent zu rechnen.
Nimmt man wie in den alten Zeiten die Börse als Vorläufer der Wirtschaftsentwicklung ernst, müsste die globale Wirtschaft schon bald in eine tiefe Rezession stürzen. Sieht man die niedrige Inflation und die niedrigen Zinsen jedoch als Voraussetzung dafür, dass sich die Konjunktur langsam aus dem Tal herauskämpft, bleibt eine andere Schlussfolgerung: Aktien sind derzeit günstig zu haben – oder sie folgen inzwischen anderen Gesetzen.
mm.de
Die US-Notenbank hat in der Krise die richtige Strategie gewählt, sagt Ulrich Beckmann, Leiter Global Markets Research bei der Deutschen Bank. In Euroland drohten dagegen eher japanische Verhältnisse mit sinkenden Preisen und geringem Wachstum.
mm.de: Immer mehr Beobachter befürchten, dass die schwachen Aktienmärkte auf die Konjunktur zurückschlagen werden. Vor allem der US-Verbraucher, die wichtigste Stütze der amerikanischen Wirtschaft, werde auf Grund der Vermögensverluste an den Börsen weniger konsumieren und die Unternehmen weniger investieren. Teilen Sie dieses Szenario?

Ulrich Beckmann, Leiter Global Markets Research bei der Deutschen Bank
Beckmann: Schwache Aktienbörsen sind kein gutes Umfeld für die Unternehmen. Die Konzerne werden vermutlich ihre Investitionspläne überdenken, zumal die Möglichkeiten der Finanzierung abnehmen. Ähnlich ist die Situation bei den Konsumenten. Insbesondere wer Aktien hält, spürt natürlich die Auswirkungen der Baisse. Die Verbraucher könnten ihre Kaufentscheidungen aufschieben. Möglicherweise wird sich die Sparquote weiter erhöhen; und aktuell ist das schlecht für die Wirtschaft.
mm.de: Wie stark schätzen Sie die Wechselwirkung zwischen schwachen Finanzmärkten und Realwirtschaft für Europa und insbesondere Deutschland ein?
Beckmann: Bei uns gibt es weniger Menschen als in den USA, die Aktien direkt oder indirekt halten. Deshalb wird der so genannte Wealth Effect hier deutlich niedriger zu veranschlagen sein als in den USA. Gleichwohl sehe ich die Gefahr, dass die spürbar schlechte Stimmung übergreift und die Zweifel am Wirtschaftsaufschwung wachsen. Das Risiko, dass schwache Aktienmärkte auf die Realwirtschaft durchschlagen, ist auch in Deutschland gegeben.
mm.de: Hier finanzieren sich die Konzerne allerdings weniger über die Börse als in den USA. Sollte das die Lage nicht entspannen?
Beckmann: Sie tun es, wenn auch in geringerem Ausmaß, etwa über neue Aktien und Anleihen. So wie ich die Stimmung einschätze, besteht derzeit aber nur geringe Bereitschaft, auf diesen beiden Kanälen vom Markt Geld zu verlangen oder auch welches zu geben. Der Preis stimmt einfach nicht. Bei der Kreditvergabe werden in unsicheren Zeiten auch strengere Maßstäbe angelegt werden.
mm.de: Der Ruf nach einer konzertierten Aktion der Notenbanken zur Belebung der Aktienmärkte wird lauter. Doch zumindest der Fed sind angesichts eines historisch niedrigen Zinsniveaus die Hände gebunden. Halten Sie eine Zinssenkung zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt für sinnvoll?
Beckmann: Das ist schwierig zu beurteilen. In den USA sind die Zinsen bereits so niedrig, dass eine weitere Absenkung die Märkte durchaus verunsichern könnte. Die Fed hätte dann auch nicht mehr viel Spielraum, erneut zu reagieren. Ich denke, die US-Notenbank sollte ihr Pulver weiter trocken halten. Für Europa wiederum sehe ich es noch nicht als ausgemacht an, dass der nächste Zinsschritt eine Zinserhöhung sein wird.
mm.de: Mit Blick auf die USA drängen sich manchen Ökonomen Parallelen zur Krise in Japan auf. Aktienbaisse, Deflation und Rezession bilden dabei die Argumentationskette. Lassen sich die Entwicklungen so ohne weiteres vergleichen?
Beckmann: Nein, in den USA haben sich die Aktienmärkte zwar ähnlich schwach entwickelt. Bei den Immobilienmärkten ist dies aber nicht der Fall. Die Investitionen wiederum gehen deutlicher zurück als seinerzeit in Japan. Gleiches gilt für das Wachstum. Der flexible Arbeitsmarkt in den USA hat es andererseits ermöglicht, dass sich die Firmen relativ rasch von ihren Mitarbeitern trennten. Daraufhin hat die Notenbank in den Vereinigten Staaten naturgemäß schneller gehandelt - anders als in Japan, wo man die Zinsen nicht rechtzeitig gesenkt hatte. Auch auf fiskalpolitischer Seite reagierten die US-Politiker zwei Jahre eher als in Japan. Ich denke, es gibt zwar ein paar Gemeinsamkeiten. Doch die Unterschiede zwischen Japan und den USA sind größer als jene zwischen Japan und Euroland.
mm.de: Sie schließen eine Rezession in den USA eher aus?
Beckmann: Natürlich besteht die Gefahr. Keiner weiß genau, wie lange die Aktienkurse noch fallen oder sie auf einem niedrigen Niveau verharren. Damit verbindet sich natürlich ein gewisses Risiko für die Konjunktur. Ich denke aber, dass sowohl Notenbank als auch US-Regierung die richtige Absicherungsstrategie gewählt haben. Sie reagierten rasch und nicht halbherzig. Von daher besteht gute Hoffnung, dass die USA von einer Entwicklung wie in Japan verschont bleiben.
mm.de: Wie schätzen Sie die Risiken für Europa ein?
Beckmann: Betrachten wir einzelne Indikatoren wie Aktien- und Arbeitsmarkt, Kreditexpansion oder Wirtschaftswachstum - da gibt es eine ganze Reihe erschreckender Parallelen zur Entwicklung in Japan Anfang der neunziger Jahre. Die muss man ernst nehmen. Nicht zu vergessen, die Inflation in Deutschland tendiert – unter Einbeziehung des Messfehlers – schon gegen Null. Wir dürfen nicht in ein Fahrwasser geraten, wie sich dies in Japan mit einem geringen Wirtschaftswachstum über Jahre sowie einem sinkenden Preisniveau ergab.
mm.de: Zurück zu den Aktienmärkten. Ab dem 14. August müssen US-Konzernchefs die Richtigkeit ihrer Bilanzen quasi beeiden. Könnte dies einen Wendepunkt für die Wall Street darstellen?
Beckmann: Das lässt sich nicht sicher beantworten. Der Investor dürfte danach den Unternehmenszahlen mehr Vertrauen schenken. Die Wirtschaftsprüfer werden jedoch in Zukunft genauer hinschauen als sie es jemals zuvor taten. Man wird sicherlich auch vorsichtiger bilanzieren als in der Vergangenheit. Entscheidend für die Aktienmärkte ist also, wie die Unternehmensergebnisse dann ausfallen, und ob sie einen Aufwärtstrend dann auch widerspiegeln.
Spätestens die jüngsten Tiefstände an den Aktienmärkten drohen den Aufschwung zu kippen. Es wäre fahrlässig, darauf nur mit guten Worten zu reagieren.
Der Absturz wird zur Routine. Seit Mitte März haben die meisten der großen Aktienbörsen der Welt zwischen einem Viertel und mehr als einem Drittel an Wert verloren. Mittlerweile braucht es wie am Mittwoch schon tägliche Kursverluste von zeitweise mehr als fünf Prozent, um das Desaster wieder präsent werden zu lassen. Und das zu Recht: Denn die Gefahr ist groß, dass die Verluste jetzt ein Niveau erreichen, das für die Realwirtschaft herbe Folgen mit sich bringt.
Noch demonstrieren die Notenbanker und Finanzpolitiker wacker Zuversicht. Und auch die meisten Volkswirte setzen bislang noch auf fast ungestörtes wirtschaftliches Wachstum. Zum Teil steckt hinter solchen Versprechen allerdings das zweifelhafte Selbstverständnis, bloß keine zusätzliche Panik stiften zu wollen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist - oder ob es nicht vielmehr dazu führt, dass die Verantwortlichen den richtigen Moment verpassen, um in den nächsten Wochen wirtschaftspolitisch einzugreifen.
Schlechtere Vorzeichen als 1987
Noch ist schwer vorhersehbar, wohin das Börsendesaster realwirtschaftlich führen wird. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es in der jüngeren Geschichte zwei höchst unterschiedliche Präzedenzfälle dafür gibt: den globalen Crash von Oktober 1987, der fast ohne Folgen für das Wirtschaftswachstum blieb, und die bis heute anhaltende und weit folgenschwerere Baisse in Japan seit Anfang der 90er Jahre.
Gegen das japanische Szenario mag sprechen, dass sich die konjunkturelle Lage diesmal seit Monaten eher bessert als verschlechtert und dass der Aufschwung zumindest in den USA sowohl von drastisch gesunkenen Zinsen als auch von einer großzügigeren Finanzpolitik gestützt wird. In Japan hatte die Notenbank Anfang der 90er Jahre dagegen zunächst auf restriktiven Kurs gesetzt. Die Investmentbank Morgan Stanley erwartet, dass die Gewinne der wichtigsten US-Firmen im zweiten Quartal erstmals wieder deutlich gestiegen sind. Der Auftragseingang deutet zudem auf steigende Investitionen.
Als verfrüht droht sich dennoch die Hoffnung zu erweisen, dass die Börsenverluste ähnlich spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen wie nach dem Crash 1987. Der Unterschied liegt zum einen in Art und Ausmaß der Aktienbaisse. Vor 15 Jahren sank etwa der US-Aktienindex S&P 500 kurz und abrupt. Binnen weniger Tage fielen die Kurse um knapp ein Drittel, um wenig später bereits die Aufholjagd wieder anzutreten: Die Verluste waren nach knapp eineinhalb Jahren wettgemacht. Diesmal setzt sich mit den jüngsten Rückgängen ein Trend fort, der seit März 2000 anhält. Alles in allem hat der S&P seitdem gut 45 Prozent verloren, der deutsche Index Dax sogar um mehr als die Hälfte.
Was die heutige Lage brenzliger machen könnte als jene von 1987 ist zudem die Vermutung, dass die jüngsten Bilanzskandale bei Enron, Worldcom und anderen nur Auslöser und nicht Ursache für den Absturz der Aktienkurse war. Die Anpassung der Bewertungen an den Finanzmärkten hätte nach dem Überschwang Ende der 90er Jahre ohnehin stattfinden müssen - die jüngsten Kursstürze zeigen lediglich, dass sich der Prozess nun schneller und mithin schmerzhafter vollzieht, als es viele erhofft hatten. Darin wiederum ähnelt die heutige Lage eher jener Japans Anfang der 90er Jahre.
Mit jedem weiteren Einbruch an den Aktienmärkten steigt seit Wochen die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher - zumindest im Aktienland USA - ihre Ausgaben bald einschränken werden. Empirische Studien deuten darauf, dass Vermögensverluste mit ein paar Jahren Verzögerung die Konsumlust spürbar verringern. Die Vertrauenskrise nach den Bilanzskandalen droht dazu zu führen, dass es Unternehmen jetzt schwerer haben an Kapital zu kommen. Spätestens damit geriete der US-Aufschwung in Gefahr - und auch die Konjunkturerholung in Europa.
Gefährliche Spirale nach unten
Noch ist der Rückfall in die Rezession nur ein mögliches Szenario. Es könnte allerdings schon in Kürze das wahrscheinlichste werden. Um so besser wäre es, wenn die Geld- und Finanzpolitiker der führenden Industrienationen sich schon jetzt auf den konjunkturellen Ernstfall vorbereiten würden.
Klar: Es wäre weder sinnvoll noch Erfolg versprechend, weitere Aktienkursverluste verhindern zu wollen, solange diese noch Teil einer Korrektur früherer Exzesse sind - auch wenn dies realwirtschaftlich spürbare Folgen hätte. Letztere wären dann nur der Preis für das entsprechend überhöhte Wachstum der Wirtschaft im vorangegangenen Boom. Nach aller Erfahrung ist das Risiko jetzt aber groß, dass sich die Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten verselbstständigt. Und zumindest das sollten Notenbanker und Regierungsvertreter zu verhindern versuchen.
Woran es derzeit mangelt, sind Finanzminister, die sich an den Märkten Respekt und Gehör verschaffen. Dazu haben weder die Vertreter Deutschlands oder Frankreichs noch Amerikas Paul O’Neill das Format. Um so hilfreicher wäre es, wenn unter den Geldpolitikern neben US-Mann Alan Greenspan auch Europas Wim Duisenberg den Finanzmarktakteuren signalisierte, dass er bereit wäre auf die erwarteten Zinserhöhungen vorerst zu verzichten - statt nach Inflationsgefahren zu suchen, die es nicht gibt. In Deutschland sind die Preise von Juni auf Juli gefallen.
Kein Börsencrash gleicht dem anderen
Die Rahmenbedingungen der Crashs an den Aktienmärkten sind unterschiedlich, doch die Grundmuster ähneln sich. Experten sehen große Parallelen zur Japan-Krise 1990.
Die aktuelle Baisse an den Aktienmärkten ist einzigartig, schon weil sie sich stufenweise verstärkt hat. In der Vergangenheit finden sich dagegen vor allem Beispiele, die mit einem "großen Knall" begonnen haben. Zwar zeigen sich im Verlauf früherer Crashs grundsätzliche Parallelen zur heutigen Situation, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen führen aber zu Abweichungen.
Die Börsen der Industrieländer sind in den vergangenen 28 Monaten auf immer neue Tiefs gefallen. Beispiel Dax: Von 8000 Indexpunkten im März 2000 wurde er mittlerweile auf rund 3600 zurechtgestutzt. Man muss schon bis 1929 in die Geschichte zurückgehen, um eine Abschwungphase zu finden, die länger gedauert hat. Nach den Crashs von 1972, 1987 und 1998 setzte die Erholung nach maximal zwei Jahren wieder ein. Die große Depression nach 1929 dauerte allerdings gleich 25 Jahre, bis im November 1954 die Indexstände der Vorkrisenzeit wieder erreicht wurden.
"Was wir heute erleben, ist mit 1929 nicht zu vergleichen", sagt Christoph Kaserer, Professor für internationale Kapitalmärkte an der Uni München. Die Fundamentaldaten sind heute anders, von einem Zusammenbruch der Realwirtschaft ist nichts zu spüren. In den vier Jahren nach 1929 sackte die Produktion weltweit um fast die Hälfte ab. Die Politik der Geldverknappung durch die Zentralbank spielte damals eine große Rolle. Erschwerend kam die Einschränkung des freien Welthandels hinzu. "Nichts davon sehen wir heute", sagt Kaserer.
Anleger folgen dem Herdentrieb
Verstärkt werden Krisen heutzutage nach Ansicht Kaserers durch das Herdenverhalten der institutionellen Anleger. Sie müssen sich immer mehr an führenden Indizes (Benchmarks) orientieren und können immer weniger eigene Akzente in der Anlagepolitik setzen.
Am Anfang des Abschwungs haben dabei häufig externe Schocks eine Rolle gespielt, der Zusammenbruch des Hedge Funds LTCM 1998 oder die Ölkrise 1972. Olaf Stotz vom Institut für Asset Management an der Uni Aachen weist auf einen weiteren Unterschied hin: den gegenwärtigen Vertrauensverlust in das Finanzsystem nach zahlreichen Bilanz- und Analystenskandalen.
Ihm scheint die aktuelle Situation mit dem Crash in Japan 1990 vergleichbar. Auch die Deutsche Bank sieht in einer Studie Gemeinsamkeiten zu heute: "Aktienmärkte, BIP-Wachstum, Investitionen, Inflation und Verlangsamung des Kreditwachstums - alles dies entwickelt sich ähnlich wie seinerzeit in Japan."
Gier geht dem Absturz voraus
Abstürze an den Märkten sind keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Als erster Crash gilt die Tulpenkrise in den Niederlanden 1636. Es folgten der Eisenbahn-Crash in Großbritannien ab 1845, oder der Absturz nach dem Gründerboom in Deutschland 1873. Häufig führt eine neue Technologie - vor 1845 die Eisenbahn, vor 1929 das Automobil, vor 2000 das Internet - zu einem kräftigen Wachstum, das bald in Übertreibung umschlägt. "Letztendlich ist die Gier der Anleger die Erklärung", sagt Stotz.
Typisch seien ein Gründerboom, kräftig wachsender privater Konsum und Korruption, erläutert der Wissenschaftler Charles Kindleberger. Darüber hinaus setze sich das Gefühl durch, eine neue Ära sei angebrochen. Regeln zur Dauer einer Krise bietet die Geschichte nicht. Fest steht nur, dass eine Bankenkrise im Anschluss an den Börsenabsturz die Probleme verschärft. Sollte jetzt ein großes Finanzinstitut zusammenbrechen, "wird das psychologisch sehr schwierig", sagt Kaserer.
Aus dem Verlauf früherer Crashs Rückschlüsse auf die heutige Situation abzuleiten, hält Joachim Goldberg für fragwürdig. Seine Firma Cognitrend hat sich auf die Untersuchung des Anlegerverhaltens spezialisiert. Grundsätzliche Muster ähnelten sich, doch die Rahmenbedingungen seien immer wieder andere. "Blasen sind schon häufig geplatzt, aber jeder Fall ist doch singulär", sagt Goldberg. Dass dennoch immer wieder Vergleiche angestellt werden, "liegt in der menschlichen Psyche begründet". "Wir suchen Erklärungen, um die Lage unter Kontrolle zu halten."
ftd.de
Gruß
Happy End

"Hier herrscht Panik, blanke Panik", rief ein Reporter des Nachrichtensenders N-tv am vergangenen Mittwoch in sein Mikrofon. Er hatte die hektische Stimme eines Kriegsreporters, der ganz vorn an der Front steht - direkt auf dem Parkett der Frankfurter Börse.

Zeugen des Absturzes: AOL-Händler an der Börse von Chicago sehen den Kurs des Konzerns fallen
Zwei Tage zuvor hatte der amerikanische Telekommunikationsriese WorldCom Konkurs angemeldet. Durch die bislang größte Pleite der Wirtschaftsgeschichte wurden 120 Milliarden Dollar vernichtet. Aus den USA wehte zudem das Gerücht heran, die US-Notenbank könne zu einer Notsitzung zusammenkommen. In Deutschland sorgten Hausdurchsuchungen bei dem Finanzdienstleister MLP ebenso für Aufruhr wie angebliche Preisabsprachen bei Versicherungen, die wie Banken prompt in den allgemeinen Abwärtsstrudel gerieten. Aktienhändler sprachen von einem "mittleren Blutbad".
An einem solchen Tag kann es angeraten sein, mit Experten wie Eckhardt Wohlers zu reden. Der Konjunkturforscher beim Hamburgischen Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) erklärt mit ruhiger Stimme, der Crash an den Börsen, der in Deutschland allein in der vergangenen Woche Kapital in Höhe von über 50 Milliarden Euro verpuffen ließ, werde für die Wirtschaftsentwicklung "keine großen Folgen" haben. Wohlers fürchtet keine Rezession. Allenfalls werde sich der Aufschwung, der für das zweite Halbjahr erwartet wurde, etwas verschieben.
In der Zwischenzeit brachen die Aktien der HypoVereinsbank um bis zu 20 Prozent ein, die der Commerzbank um über 13 und die der Deutschen Bank um fast 10. "Atmen Sie erst einmal durch", riet der N-tv-Moderator seinen Zuschauern, "wir sind gleich wieder für Sie da." Nach der Werbepause ging es weiter - abwärts.
Der Dax, der im März des Jahres 2000 noch bei über 8000 Punkten lag, notierte am vergangenen Freitag nur noch bei 3580. Der US-Index Dow Jones schmierte im gleichen Zeitraum von 11 100 auf gut 8000 Punkte ab. Und all diese Beben sollen keine Auswirkungen auf Wachstum, Investitionen und Arbeitsplätze haben?
In solchen Momenten kann es auch beruhigend wirken, mit Wolfgang Wiegard zu reden, Chef jenes Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der sich "Die fünf Weisen" nennen lässt. "Die Auswirkungen der Aktienmärkte auf die reale Wirtschaft schätze ich gegenwärtig eher gering ein", sagt Wiegard. Die Gefahr, dass der Kurssturz gar eine neue Rezession einleiten könnte, sieht er "zurzeit ganz und gar nicht".

Ratlosigkeit: Selten hat der Handel an den Börsen solche Ausschläge verzeichnet wie vergangene Woche
Seine Erklärung wie auch die vieler seiner Kollegen: Die Entwicklung an der Börse habe sich von der wirtschaftlichen Realität abgekoppelt. Während die Aktienkurse noch abstürzten, vor allem weil die Anleger nach den Skandalen um Enron und Co. das Vertrauen in Bilanzen und Unternehmensführer verloren haben, gebe es genügend Aufschwungsignale wie das stabile Wachstum in den USA. Auf Dauer setze sich die reale Wirtschaft gegen die kurzfristigen Trends der Börsen durch.
Doch mit jedem Tag, an dem die Kurse weiter sinken, wachsen die Zweifel, ob Konjunkturforscher wie Wohlers und Wiegard mit ihren Analysen wirklich richtig liegen. Denn es scheint keineswegs zwingend, dass die bislang gute US-Konjunktur dafür sorgt, die Unternehmensgewinne und damit auch die Börsenkurse wieder nach oben zu ziehen. Möglich ist derzeit durchaus auch die umgekehrte Entwicklung: Die einstürzenden Börsenkurse könnten die gesamte Ökonomie mit in die Tiefe reißen.
- Sparer, die beim Spekulieren ihr Geld verloren haben, schränken schon jetzt ihren Konsum ein. Bei Herstellern von Unterhaltungselektronik, bei Autokonzernen, Kaufhäusern, Reiseveranstaltern und im Gast-Gewerbe sinken die Einnahmen drastisch.
- Banken bilden Rückstellungen für faule Kredite. Sie müssen ihre Kosten senken, streichen Tausende von Jobs und vergeben zunehmend widerwillig neue Kredite.
- Unternehmen können sich das Geld aber auch nicht mehr so leicht an der Börse besorgen. Sie senken ihre Investitionen. Firmengründer haben kaum noch eine Chance, frisches Kapital für weitere Expansionen an der Börse zu bekommen.
- Versicherungen können ihren Kunden die garantierte Dividende nicht mehr aus den erwirtschafteten Überschüssen bezahlen. Also müssen sie Aktienpakete verkaufen und beschleunigen damit nur weiter den Absturz der Papiere.
Eine schwer zu durchbrechende Abwärtsspirale, die Industrie wie Kleinsparer, Arbeitsplätze wie Altersversorgung gleichermaßen bedroht? Ein Horrorszenario? Gewiss. Aber es mehren sich die Alarmsignale.
Am vergangenen Donnerstag legte das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung einen wichtigen Frühindikator für die Konjunkturentwicklung vor, den so genannten Geschäftsklima-Index. Dafür befragen die Forscher 7000 Unternehmen nach ihren Geschäftserwartungen. Jüngstes Ergebnis: Die Firmen sind im Juli deutlich pessimistischer geworden. Wenn es im August so weitergeht, sagt Ifo-Präsident Hans-Werner Sinn, müsse man davon ausgehen, dass der viel beschworene Aufschwung stockt.
Für Finanzminister Hans Eichel steht die Hauptursache fest: Die starken Kursverluste an den Weltbörsen, die ein "Gefährdungsfaktor" für die Konjunktur geworden seien - da solle man "gar nicht herumreden".
Die Folgen der Börsenbaisse lassen sich zuallererst bei den Banken beobachten. Und bei denen könnte es düsterer kaum aussehen. Albrecht Schmidt, Vorstandsvorsitzender der HypoVereinsbank, orakelt: "Wir bewegen uns im schwersten Bankenjahr seit Kriegsende." Die Kreditinstitute reagieren nach bekanntem Muster: Sie streichen Arbeitsplätze. Allein die vier privaten Großbanken haben den Abbau von 35.000 Jobs angekündigt.
Besonders stark auf Geschäfte rund um die Börse hat die Deutsche Bank gesetzt. Die Kreditvergabe an den Mittelstand hat sie zurückgefahren, weil das Geschäft als wenig lukrativ gilt. Stattdessen wurden Unternehmensführer wie WorldCom-Gründer Bernie Ebbers oder der französische Vivendi-Chef Jean-Marie Messier mit großzügigen Kreditlinien hofiert.
Die Bank benutzte die Kredite wie ein Eintrittsgeld, um mit solchen Konzernen dann ins lukrative Geschäft der Unternehmensübernahmen oder der Emission von Anleihen zu kommen. Doch der Preis ist, wie die Deutsche Bank jetzt zu spüren bekommt, viel höher als erwartet. Sie muss ihre Risikovorsorge für Kredite, die möglicherweise nie zurückgezahlt werden, um mehrere hundert Millionen Euro aufstocken. Allein bei WorldCom war Deutschlands größte Bank mit 241 Millionen Dollar engagiert.
Die Krise der Finanzindustrie wirft dunkle Schatten auch auf die übrige Wirtschaft und gefährdet Arbeitsplätze in ganz anderen Industriezweigen wie dem Maschinenbau oder der Software-Industrie. Unternehmer, die auf frisches Geld zum Ausbau ihres Geschäfts angewiesen sind, geraten immer weiter ins Trudeln. "Der Kapitalmarkt ist tot", sagt ein Investmentbanker.
Bis zu 60 Neuemissionen sollte es nach einer Prognose von Sal. Oppenheim dieses Jahr in Deutschland geben. Den Sprung aufs Parkett geschafft haben bislang aber nur fünf Firmen. Etliche andere Unternehmen wie beispielsweise der Weilheimer Solarzellenhersteller SES 21 mussten ihren Börsengang kurzfristig wieder absagen.
Die Börse fällt als Risikokapitalgeber also bis auf weiteres aus. Gleichzeitig aber kappen viele Banken die Kreditlinien. Der Stuttgarter Wirtschaftsanwalt Brun-Hagen Hennerkes, der im Aufsichtsrat größerer Mittelständler sitzt, diagnostiziert: "Viele Hausbanken lassen ihre Mittelstandskunden im Regen stehen."
Schwer getroffen werden von der Börsenbaisse aber auch die Lebensversicherungsgesellschaften. Sie sind gesetzlich gezwungen, ihren Kunden eine Verzinsung von 3,25 Prozent zu garantieren. In den Jahren des Aktienbooms haben auch deutsche Versicherungen immer mehr Kapital in Aktien angelegt. Bei fallenden Kursen müssen sie jetzt verkaufen, um überhaupt die Garantieverzinsung zahlen zu können. Dies war, wie Börsenhändler berichten, einer der rationalen Gründe, warum die Kurse jüngst so stark absackten. Hinzu kommt ein fast noch wichtigerer Faktor: die Furcht.
Ein Großteil des Geschehens an den Börsen lässt sich nur noch mit dem Instrumentarium der Psychologie erklären. Da meldete Siemens am vergangenen Mittwoch hervorragende Quartalszahlen, hat schon in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs mehr verdient, als der Konzern für das gesamte Jahr prognostizierte - und wie reagierte der Kurs? Er sackte teilweise um mehr als neun Prozent ab.
Aktienhändler begründeten das Debakel damit, dass bei Siemens der Auftragseingang fürs vierte Quartal gesunken sei. Psychologen nennen derlei selektive Wahrnehmung.
Positive Nachrichten werden nicht mehr zur Kenntnis genommen. Jedes Gerücht aber, das einer Bank gestiegenen Abschreibungsbedarf unterstellt oder einem Unternehmen geschönte Bilanzen, wird gierig aufgegriffen und führt zu Einbrüchen nicht nur bei den vermeintlich betroffenen Firmen. Abgestraft werden meist auch andere Unternehmen, die in der gleichen Branche aktiv sind. Als der US-Pharmakonzern Merck wegen Bilanztricks ins Gerede kam, rutschte der Kurs des gleichnamigen deutschen Unternehmens im Gleichklang ab - obwohl die beiden Konzerne keinerlei Berührungspunkte haben.
Und wenn sich später herausstellt, dass ein Gerücht nur ein Gerücht war, steigen die Kurse selten auf das alte Niveau. Es könnte ja doch etwas dran sein.
Das blinde Vertrauen, das die meisten Anleger während des Booms Ende der neunziger Jahre in Bilanzen und Prognosen der Konzerne hatten, hat sich ins Gegenteil verkehrt: ein ebenso blindes Misstrauen. Entsprechend heftig sind die Kursausschläge an den Börsen, an denen vor allem ein Wort Konjunktur hat: Angst.
Nur eine Spezies von Wirtschaftsprofis lässt sich davon nicht anstecken, die der Konjunkturforscher. Die Auguren verweisen gebetsmühlenartig darauf, dass der Börsencrash in Deutschland schon deshalb keine großen Auswirkungen haben dürfte, weil hier zu Lande nur gut 18 Prozent der Bevölkerung Aktien besitzen. Fallende Kurse dürften kaum zu einer sinkenden Konsumnachfrage führen. Ganz anders in den USA, wo die Aktienkultur viel tiefer verwurzelt sei - und nun Millionen Senioren um die Altersvorsorge ihrer Pensionsfonds fürchten.
Aber was geschieht, wenn auch die kauffreudigsten Verbraucher der Welt, die US-Amerikaner, ihr Geld lieber sparen? Dann, so gestehen auch Konjunkturforscher, drohe tatsächlich Gefahr, auch für Europa.
Das Szenario ist schnell skizziert: Der Kurs des Dollar würde stärker sinken, der des Euro steigen. Deutsche Maschinenbauer, Chemiefirmen und Autohersteller könnten kaum noch so viel in die USA exportieren. Und weil diese Ausfuhren bislang eine der wichtigsten Stützen der deutschen Wirtschaft sind, drohten dann auch hier Rezession, noch mehr Pleiten und ein noch mieseres Konsumklima, das wiederum die Aktienmärkte mit sich reißen würde.
Gegensteuern könnten vor allem Wirtschaftspolitiker und Notenbanken. Sie können, ganz traditionell, die Leitzinsen senken. Aber auch völlig ungewöhnliche Vorschläge werden diskutiert. Die Schweizer Investmentbank Credit Suisse First Boston präsentiert in einer Studie die Idee, dass die Notenbanken an der Börse Aktien kaufen könnten. Der Vorschlag klingt abenteuerlich. Aber er zeigt, wie dramatisch die Entwicklung von einigen Experten mittlerweile eingeschätzt wird.
Angesichts solcher Äußerungen fällt es zunehmend schwer, sich von den eher unspektakulären Analysen der Wirtschaftswissenschaftler beruhigen zu lassen. Nur wenn die Kurse noch kräftig weiter absacken und dauerhaft unten bleiben, sieht Konjunkturforscher Wohlers vom HWWA echte Gefahren.
Und der oberste Wirtschaftsweise, Professor Wiegard, ist weiterhin überzeugt: "Der Aufschwung kommt, wenn auch vielleicht etwas später als erwartet."
spiegel.de
Börse als Bremsklotz
Die Weltwirtschaft klettert mühsam aus dem Tal, doch die Börse geht ihre eigenen Wege. Die Indizes haben sich vom Konjunkturverlauf gelöst und drücken nun auf das Vertrauen der Verbraucher. Wie groß ist die Gefahr, dass die Wall Street nun auch die "Real Street" mit sich reißt?

Einst eilte die Börse der Konjunktur voraus. Nun droht sie die Wirtschaft zu lähmen.
Damals, in den alten Zeiten, gab es noch Anhaltspunkte. Da reagierte die Börse noch auf Veränderungen der globalen Konjunktur. Wie ein Seismograf schlug sie auf wichtige Frühindikatoren an und eilte der Entwicklung der Wirtschaft um sechs bis acht Monate voraus. Auch damals ließen sich keine Kurse vorhersagen, doch auf lange Sicht verliefen die Indizes zeitversetzt, aber im Einklang mit der Konjunkturkurve. In den alten Zeiten.
Inzwischen ist die Welt komplizierter geworden. Nach Ansicht der Volkswirte hat die Konjunktur in den USA bereits vor sieben Monaten ihre Talsohle durchschritten, doch die Indizes markieren fast jede Woche neue Tiefs. Die Wirtschaft scheint sich langsam zu berappeln, aber die Finanzmärkte marschieren konsequent in die andere Richtung. Von Erholung keine Spur: Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Börsen in einem vergleichbar robusten Konjunkturumfeld so schwach wie heute, bemerken die Volkswirte von Goldman Sachs. Bilanzskandale und die tiefe Verunsicherung der Aktionäre sorgen dafür, dass Auftragseingänge und Wirtschaftswachstum beinahe ungehört verhallen.
Das Kursbarometer an der Wall Street hat sich nicht nur von der "Real Street" gelöst – nun droht das Pendel auch auf die reale Wirtschaftsentwicklung zurückzuschlagen.
Der Aktiencrash könnte die zaghafte Konjunkturerholung wieder ersticken: Nach Ansicht von Stephen Roach, Chefvolkswirt bei Morgan Stanley, droht durch die extrem schwachen Märkte ein "double dip", ein Rückschlag in die Rezession.
Selbst der bedächtige Bundesbank-Präsident Ernst Welteke sorgt sich darüber, dass sich "die Unsicherheiten an den Finanzmärkten auf die Realwirtschaft auswirken". Die Baisse hat enormes Kapital vernichtet, Löcher in Konzernportfolios und Privatschatullen gerissen und für Unsicherheit bei Firmenchefs wie bei Verbrauchern gesorgt. Einiges spricht dafür, dass die Börsenkurve nun auch die Konjunkturkurve erneut nach unten drückt.
Konsum gerät ins Wanken
Mit Bangen blicken Börsianer auf den Verbraucher in den USA. Bislang hat dieser kräftig weiter eingekauft, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Verluste in den Depots wieder ausgeglichen sind. Die niedrigen Zinsen haben die Konsumlust auch nach den Attentaten im September stimuliert: Viele US-Bürger schuldeten ihr Darlehen für das Haus auf einen niedrigeren Zinssatz um und gingen mit dem gesparten Geld erneut auf Einkaufstour. Die günstigen Finanzierungs- und teilweise Nullzins-Angebote der Auto- und Konsumartikelhersteller waren ja auch verlockend. Zusätzlich floss viel ausländisches Kapital ins Land, was das Leben auf Pump erleichterte.
Doch mit den US-Bilanzskandalen ebbt dieser Geldstrom ab, und das Vertrauen der Amerikaner, das beste Finanzsystem der Welt werde alles richten, ist angeknackst. Hinzu kommt die Sorge, auf Grund des Streichkonzerts der Konzerne bald selbst ohne Job zu sein, und die tiefe Enttäuschung beim Blick auf das eigene Depot. Das Vermögen der privaten Haushalte in den USA ist seit März 2000 um rund 4000 Milliarden Dollar geschrumpft – nach Schätzungen der US-Notenbank könnte dies eine Konsumeinschränkung von 180 Milliarden Dollar bedeuten, wenn die Verbraucher aus der Geldvernichtung Konsequenzen ziehen und das Sparen entdecken.
Zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der USA entfallen auf den privaten Verbrauch und der US-Einzelhandel verbuchte zuletzt bereits leicht rückläufige Umsätze, und das Vertrauen der US-Verbraucher ist im Juli auf den tiefsten Stand seit September gefallen. Hält dieser Trend an, dürften die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den USA hinfällig sein.
Geschäftsklima in Deutschland abgekühlt
Der Wertverlust der Aktien schmälert auch die Pensionen der US-Rentner. Aktien spielen in der privaten Altersvorsorge in den USA eine wichtige Rolle, und in vielen US-Pensionsfonds sind Aktien gegenüber Rentenpapieren viel stärker gewichtet als in vergleichbaren europäischen Fonds. Neben den Alltagsausgaben sollten häufig auch die Schulden aus den Gewinnen der Aktienfonds abbezahlt werden. Nun müssen viele Ruheständler knapper kalkulieren.
In Deutschland gibt es nicht so viele Aktiensparer wie in den USA, so dass ein weiterer Kursverfall nicht ganz so stark auf privates Vermögen und Konsum durchschlagen dürfte. Nur etwa jeder fünfte Deutsche hält Wertpapiere, während in den USA Aktien bereits ein fester Bestandteil der privaten Altersvorsorge sind. Dennoch hat der Kursrutsch in den Jahren 2000 und 2001 auch hierzulande rund 160 Milliarden Euro vernichtet, und der private Konsum ist mit 50 Prozent des Bruttosozialproduktes die entscheidende Stütze der Wirtschaft.
Die Teuro-Diskussion und wachsende Sorge um den Arbeitsplatz haben dazu geführt, dass die Konsumenten in Deutschland bereits seit Frühjahr deutlich zurückhaltender sind als in den USA: Einzelhändler beklagen einen "Käuferstreik". Entsprechend schwach fiel auch der Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli aus. "Der Konsum ist noch nicht in Schwung gekommen, und die Unternehmen halten sich nach wie vor zurück", sagt Ifo-Chefökonom Gernot Nerb. "Damit bringen die Triebkräfte der Konjunktur noch nicht das, was man von ihnen erwartet."
Teure Kredite, zaghafte Investitionen
Unternehmen haben ihre Investitionen zurückgefahren, da ihre Umsatz- und Gewinnprognosen nur noch auf tönernen Füßen stehen. Gleichzeitig wird es für sie schwieriger, sich für neue Projekte Geld zu beschaffen: Ein Börsengang oder eine Kapitalerhöhung kommt im aktuell schwachen Marktumfeld kaum in Frage. Auch die Banken stellen höhere Hürden auf: Die Kredite werden teurer, da die Finanzinstitute auf Grund der zahlreichen Firmenpleiten höhere Rückstellungen bilden müssen. Dies drückt besonders den Mittelstand.
Falls die Anleger ihr Geld weiter vom Kapitalmarkt abziehen, sinkt zudem das Eigenkapital der Big Player im Vergleich zu ihren Schulden – Herabstufungen der Ratingagenturen und teurere Kredite sind die Folge. "In vielen Unternehmen sind Unternehmen eigentlich überfällig", sagt Ifo-Volkswirt Nerb. Doch bei einer weiteren Verknappung von Kapital werden die Finanzierungsbedingungen immer schwieriger. Für die dringend benötigten Investitionen ist dies Gift.
Folgen der fetten Jahre – Gespenst Japan geht um
Besonders die Wachstumsunternehmen leiden noch heute unter den Folgen der fetten Börsenjahre seit Mitte der neunziger Jahre. Umsatz- und Gewinnerwartungen schienen keine Grenzen zu kennen, die Märkte erwarteten pro Quartal abenteuerliche Wachstumsraten.
In diesem Wachstumsrausch haben viele Firmen riesige Überkapazitäten geschaffen, die zum Teil bis heute noch nicht abgebaut sind. Ein großes Güterangebot stößt auf geringe Nachfrage. Dies sorgt für einen anhaltenden Preisverfall. Schon geht die Angst vor japanischen Verhältnissen um: Dort war die Spekulationsblase Ende der achtziger Jahre geplatzt, und das Land hat sich bis heute nicht erholt.
Experten betonen jedoch, dass die US-Notenbank durch ihre aggressiven Zinssenkungen die richtige Abwehrstrategie gewählt hat. Durch eine frühere, stimulierende Geldpolitik hätte die Deflation in Japan vielleicht vermieden werden können, so eine Studie der Fed. Allerdings sind auch in den USA die Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau angekommen. Sollten die Aktienmärkte weiter einbrechen, hat auch die Notenbank kaum noch Spielraum, mit Zinssenkungen zu reagieren.
Nach Ansicht von Marktbeobachtern könnte selbst eine weitere Zinssenkung in der allgemeinen Nervosität verpuffen – und dann bleibt kaum noch Luft nach unten. Die Europäische Zentralbank (EZB) nimmt in ihren Zinsentscheidungen traditionsgemäß weniger Rücksicht auf die Kapitalmärkte als die US-Notenbank und achtet stärker auf Inflationsrisiken. Volkswirte befürchten, eine Zinserhöhung der EZB im Herbst könnte den ohnehin stotternden Konjunkturmotor drosseln.
Euro in dünner Höhenluft
Die Nervosität an der Wall Street und der Vertrauensverlust gegenüber Corporate America bewegen viele Investoren dazu, von Dollar auf Euro umzuschichten. Der Aufschwung des Euro, der zum Wochenende erneut über der Dollar-Parität notierte, vollzieht sich jedoch in einem volkswirtschaftlich eher ungesunden Tempo.
Falls Herdentrieb und "irrational exuberance" der Anleger die Gemeinschaftswährung weiter nach oben treiben, sieht die europäische Exportwirtschaft schweren Zeiten entgegen. Nach Berechnungen der Investmentbank Morgan Stanley würde ein Euro-Anstieg auf 1,15 Dollar die Exporte der europäischen Unternehmen um sechs Prozent verringern.
Doch nach jeder "irrationalen Übertreibung" folgt auch wieder eine Beruhigung, argumentieren Optimisten. Ebenso wie in den Boomjahren 1999/2000 die Risiken ignoriert worden seien, würden jetzt trotz vergleichsweise robuster Konjunktur die Gefahren überschätzt. Zu diesen Optimisten zählt auch Notenbankchef Alan Greenspan: Die Konjunkturentwicklung sei auf dem richtigen Weg und im nächsten Jahr sei wieder mit einem Wirtschaftswachstum von rund 3,75 Prozent zu rechnen.
Nimmt man wie in den alten Zeiten die Börse als Vorläufer der Wirtschaftsentwicklung ernst, müsste die globale Wirtschaft schon bald in eine tiefe Rezession stürzen. Sieht man die niedrige Inflation und die niedrigen Zinsen jedoch als Voraussetzung dafür, dass sich die Konjunktur langsam aus dem Tal herauskämpft, bleibt eine andere Schlussfolgerung: Aktien sind derzeit günstig zu haben – oder sie folgen inzwischen anderen Gesetzen.
mm.de
"Europa zeigt erschreckende Parallelen zu Japan"
Die US-Notenbank hat in der Krise die richtige Strategie gewählt, sagt Ulrich Beckmann, Leiter Global Markets Research bei der Deutschen Bank. In Euroland drohten dagegen eher japanische Verhältnisse mit sinkenden Preisen und geringem Wachstum.
mm.de: Immer mehr Beobachter befürchten, dass die schwachen Aktienmärkte auf die Konjunktur zurückschlagen werden. Vor allem der US-Verbraucher, die wichtigste Stütze der amerikanischen Wirtschaft, werde auf Grund der Vermögensverluste an den Börsen weniger konsumieren und die Unternehmen weniger investieren. Teilen Sie dieses Szenario?

Ulrich Beckmann, Leiter Global Markets Research bei der Deutschen Bank
Beckmann: Schwache Aktienbörsen sind kein gutes Umfeld für die Unternehmen. Die Konzerne werden vermutlich ihre Investitionspläne überdenken, zumal die Möglichkeiten der Finanzierung abnehmen. Ähnlich ist die Situation bei den Konsumenten. Insbesondere wer Aktien hält, spürt natürlich die Auswirkungen der Baisse. Die Verbraucher könnten ihre Kaufentscheidungen aufschieben. Möglicherweise wird sich die Sparquote weiter erhöhen; und aktuell ist das schlecht für die Wirtschaft.
mm.de: Wie stark schätzen Sie die Wechselwirkung zwischen schwachen Finanzmärkten und Realwirtschaft für Europa und insbesondere Deutschland ein?
Beckmann: Bei uns gibt es weniger Menschen als in den USA, die Aktien direkt oder indirekt halten. Deshalb wird der so genannte Wealth Effect hier deutlich niedriger zu veranschlagen sein als in den USA. Gleichwohl sehe ich die Gefahr, dass die spürbar schlechte Stimmung übergreift und die Zweifel am Wirtschaftsaufschwung wachsen. Das Risiko, dass schwache Aktienmärkte auf die Realwirtschaft durchschlagen, ist auch in Deutschland gegeben.
mm.de: Hier finanzieren sich die Konzerne allerdings weniger über die Börse als in den USA. Sollte das die Lage nicht entspannen?
Beckmann: Sie tun es, wenn auch in geringerem Ausmaß, etwa über neue Aktien und Anleihen. So wie ich die Stimmung einschätze, besteht derzeit aber nur geringe Bereitschaft, auf diesen beiden Kanälen vom Markt Geld zu verlangen oder auch welches zu geben. Der Preis stimmt einfach nicht. Bei der Kreditvergabe werden in unsicheren Zeiten auch strengere Maßstäbe angelegt werden.
mm.de: Der Ruf nach einer konzertierten Aktion der Notenbanken zur Belebung der Aktienmärkte wird lauter. Doch zumindest der Fed sind angesichts eines historisch niedrigen Zinsniveaus die Hände gebunden. Halten Sie eine Zinssenkung zum gegenwärtigen Zeitpunkt überhaupt für sinnvoll?
Beckmann: Das ist schwierig zu beurteilen. In den USA sind die Zinsen bereits so niedrig, dass eine weitere Absenkung die Märkte durchaus verunsichern könnte. Die Fed hätte dann auch nicht mehr viel Spielraum, erneut zu reagieren. Ich denke, die US-Notenbank sollte ihr Pulver weiter trocken halten. Für Europa wiederum sehe ich es noch nicht als ausgemacht an, dass der nächste Zinsschritt eine Zinserhöhung sein wird.
mm.de: Mit Blick auf die USA drängen sich manchen Ökonomen Parallelen zur Krise in Japan auf. Aktienbaisse, Deflation und Rezession bilden dabei die Argumentationskette. Lassen sich die Entwicklungen so ohne weiteres vergleichen?
Beckmann: Nein, in den USA haben sich die Aktienmärkte zwar ähnlich schwach entwickelt. Bei den Immobilienmärkten ist dies aber nicht der Fall. Die Investitionen wiederum gehen deutlicher zurück als seinerzeit in Japan. Gleiches gilt für das Wachstum. Der flexible Arbeitsmarkt in den USA hat es andererseits ermöglicht, dass sich die Firmen relativ rasch von ihren Mitarbeitern trennten. Daraufhin hat die Notenbank in den Vereinigten Staaten naturgemäß schneller gehandelt - anders als in Japan, wo man die Zinsen nicht rechtzeitig gesenkt hatte. Auch auf fiskalpolitischer Seite reagierten die US-Politiker zwei Jahre eher als in Japan. Ich denke, es gibt zwar ein paar Gemeinsamkeiten. Doch die Unterschiede zwischen Japan und den USA sind größer als jene zwischen Japan und Euroland.
mm.de: Sie schließen eine Rezession in den USA eher aus?
Beckmann: Natürlich besteht die Gefahr. Keiner weiß genau, wie lange die Aktienkurse noch fallen oder sie auf einem niedrigen Niveau verharren. Damit verbindet sich natürlich ein gewisses Risiko für die Konjunktur. Ich denke aber, dass sowohl Notenbank als auch US-Regierung die richtige Absicherungsstrategie gewählt haben. Sie reagierten rasch und nicht halbherzig. Von daher besteht gute Hoffnung, dass die USA von einer Entwicklung wie in Japan verschont bleiben.
mm.de: Wie schätzen Sie die Risiken für Europa ein?
Beckmann: Betrachten wir einzelne Indikatoren wie Aktien- und Arbeitsmarkt, Kreditexpansion oder Wirtschaftswachstum - da gibt es eine ganze Reihe erschreckender Parallelen zur Entwicklung in Japan Anfang der neunziger Jahre. Die muss man ernst nehmen. Nicht zu vergessen, die Inflation in Deutschland tendiert – unter Einbeziehung des Messfehlers – schon gegen Null. Wir dürfen nicht in ein Fahrwasser geraten, wie sich dies in Japan mit einem geringen Wirtschaftswachstum über Jahre sowie einem sinkenden Preisniveau ergab.
mm.de: Zurück zu den Aktienmärkten. Ab dem 14. August müssen US-Konzernchefs die Richtigkeit ihrer Bilanzen quasi beeiden. Könnte dies einen Wendepunkt für die Wall Street darstellen?
Beckmann: Das lässt sich nicht sicher beantworten. Der Investor dürfte danach den Unternehmenszahlen mehr Vertrauen schenken. Die Wirtschaftsprüfer werden jedoch in Zukunft genauer hinschauen als sie es jemals zuvor taten. Man wird sicherlich auch vorsichtiger bilanzieren als in der Vergangenheit. Entscheidend für die Aktienmärkte ist also, wie die Unternehmensergebnisse dann ausfallen, und ob sie einen Aufwärtstrend dann auch widerspiegeln.
Die Welt schleicht zum Abgrund
Spätestens die jüngsten Tiefstände an den Aktienmärkten drohen den Aufschwung zu kippen. Es wäre fahrlässig, darauf nur mit guten Worten zu reagieren.
Der Absturz wird zur Routine. Seit Mitte März haben die meisten der großen Aktienbörsen der Welt zwischen einem Viertel und mehr als einem Drittel an Wert verloren. Mittlerweile braucht es wie am Mittwoch schon tägliche Kursverluste von zeitweise mehr als fünf Prozent, um das Desaster wieder präsent werden zu lassen. Und das zu Recht: Denn die Gefahr ist groß, dass die Verluste jetzt ein Niveau erreichen, das für die Realwirtschaft herbe Folgen mit sich bringt.
Noch demonstrieren die Notenbanker und Finanzpolitiker wacker Zuversicht. Und auch die meisten Volkswirte setzen bislang noch auf fast ungestörtes wirtschaftliches Wachstum. Zum Teil steckt hinter solchen Versprechen allerdings das zweifelhafte Selbstverständnis, bloß keine zusätzliche Panik stiften zu wollen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist - oder ob es nicht vielmehr dazu führt, dass die Verantwortlichen den richtigen Moment verpassen, um in den nächsten Wochen wirtschaftspolitisch einzugreifen.
Schlechtere Vorzeichen als 1987
Noch ist schwer vorhersehbar, wohin das Börsendesaster realwirtschaftlich führen wird. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass es in der jüngeren Geschichte zwei höchst unterschiedliche Präzedenzfälle dafür gibt: den globalen Crash von Oktober 1987, der fast ohne Folgen für das Wirtschaftswachstum blieb, und die bis heute anhaltende und weit folgenschwerere Baisse in Japan seit Anfang der 90er Jahre.
Gegen das japanische Szenario mag sprechen, dass sich die konjunkturelle Lage diesmal seit Monaten eher bessert als verschlechtert und dass der Aufschwung zumindest in den USA sowohl von drastisch gesunkenen Zinsen als auch von einer großzügigeren Finanzpolitik gestützt wird. In Japan hatte die Notenbank Anfang der 90er Jahre dagegen zunächst auf restriktiven Kurs gesetzt. Die Investmentbank Morgan Stanley erwartet, dass die Gewinne der wichtigsten US-Firmen im zweiten Quartal erstmals wieder deutlich gestiegen sind. Der Auftragseingang deutet zudem auf steigende Investitionen.
Als verfrüht droht sich dennoch die Hoffnung zu erweisen, dass die Börsenverluste ähnlich spurlos an der Wirtschaft vorbeigehen wie nach dem Crash 1987. Der Unterschied liegt zum einen in Art und Ausmaß der Aktienbaisse. Vor 15 Jahren sank etwa der US-Aktienindex S&P 500 kurz und abrupt. Binnen weniger Tage fielen die Kurse um knapp ein Drittel, um wenig später bereits die Aufholjagd wieder anzutreten: Die Verluste waren nach knapp eineinhalb Jahren wettgemacht. Diesmal setzt sich mit den jüngsten Rückgängen ein Trend fort, der seit März 2000 anhält. Alles in allem hat der S&P seitdem gut 45 Prozent verloren, der deutsche Index Dax sogar um mehr als die Hälfte.
Was die heutige Lage brenzliger machen könnte als jene von 1987 ist zudem die Vermutung, dass die jüngsten Bilanzskandale bei Enron, Worldcom und anderen nur Auslöser und nicht Ursache für den Absturz der Aktienkurse war. Die Anpassung der Bewertungen an den Finanzmärkten hätte nach dem Überschwang Ende der 90er Jahre ohnehin stattfinden müssen - die jüngsten Kursstürze zeigen lediglich, dass sich der Prozess nun schneller und mithin schmerzhafter vollzieht, als es viele erhofft hatten. Darin wiederum ähnelt die heutige Lage eher jener Japans Anfang der 90er Jahre.
Mit jedem weiteren Einbruch an den Aktienmärkten steigt seit Wochen die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucher - zumindest im Aktienland USA - ihre Ausgaben bald einschränken werden. Empirische Studien deuten darauf, dass Vermögensverluste mit ein paar Jahren Verzögerung die Konsumlust spürbar verringern. Die Vertrauenskrise nach den Bilanzskandalen droht dazu zu führen, dass es Unternehmen jetzt schwerer haben an Kapital zu kommen. Spätestens damit geriete der US-Aufschwung in Gefahr - und auch die Konjunkturerholung in Europa.
Gefährliche Spirale nach unten
Noch ist der Rückfall in die Rezession nur ein mögliches Szenario. Es könnte allerdings schon in Kürze das wahrscheinlichste werden. Um so besser wäre es, wenn die Geld- und Finanzpolitiker der führenden Industrienationen sich schon jetzt auf den konjunkturellen Ernstfall vorbereiten würden.
Klar: Es wäre weder sinnvoll noch Erfolg versprechend, weitere Aktienkursverluste verhindern zu wollen, solange diese noch Teil einer Korrektur früherer Exzesse sind - auch wenn dies realwirtschaftlich spürbare Folgen hätte. Letztere wären dann nur der Preis für das entsprechend überhöhte Wachstum der Wirtschaft im vorangegangenen Boom. Nach aller Erfahrung ist das Risiko jetzt aber groß, dass sich die Abwärtsbewegung an den Aktienmärkten verselbstständigt. Und zumindest das sollten Notenbanker und Regierungsvertreter zu verhindern versuchen.
Woran es derzeit mangelt, sind Finanzminister, die sich an den Märkten Respekt und Gehör verschaffen. Dazu haben weder die Vertreter Deutschlands oder Frankreichs noch Amerikas Paul O’Neill das Format. Um so hilfreicher wäre es, wenn unter den Geldpolitikern neben US-Mann Alan Greenspan auch Europas Wim Duisenberg den Finanzmarktakteuren signalisierte, dass er bereit wäre auf die erwarteten Zinserhöhungen vorerst zu verzichten - statt nach Inflationsgefahren zu suchen, die es nicht gibt. In Deutschland sind die Preise von Juni auf Juli gefallen.
Kein Börsencrash gleicht dem anderen
Die Rahmenbedingungen der Crashs an den Aktienmärkten sind unterschiedlich, doch die Grundmuster ähneln sich. Experten sehen große Parallelen zur Japan-Krise 1990.
Die aktuelle Baisse an den Aktienmärkten ist einzigartig, schon weil sie sich stufenweise verstärkt hat. In der Vergangenheit finden sich dagegen vor allem Beispiele, die mit einem "großen Knall" begonnen haben. Zwar zeigen sich im Verlauf früherer Crashs grundsätzliche Parallelen zur heutigen Situation, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen führen aber zu Abweichungen.
Die Börsen der Industrieländer sind in den vergangenen 28 Monaten auf immer neue Tiefs gefallen. Beispiel Dax: Von 8000 Indexpunkten im März 2000 wurde er mittlerweile auf rund 3600 zurechtgestutzt. Man muss schon bis 1929 in die Geschichte zurückgehen, um eine Abschwungphase zu finden, die länger gedauert hat. Nach den Crashs von 1972, 1987 und 1998 setzte die Erholung nach maximal zwei Jahren wieder ein. Die große Depression nach 1929 dauerte allerdings gleich 25 Jahre, bis im November 1954 die Indexstände der Vorkrisenzeit wieder erreicht wurden.
"Was wir heute erleben, ist mit 1929 nicht zu vergleichen", sagt Christoph Kaserer, Professor für internationale Kapitalmärkte an der Uni München. Die Fundamentaldaten sind heute anders, von einem Zusammenbruch der Realwirtschaft ist nichts zu spüren. In den vier Jahren nach 1929 sackte die Produktion weltweit um fast die Hälfte ab. Die Politik der Geldverknappung durch die Zentralbank spielte damals eine große Rolle. Erschwerend kam die Einschränkung des freien Welthandels hinzu. "Nichts davon sehen wir heute", sagt Kaserer.
Anleger folgen dem Herdentrieb
Verstärkt werden Krisen heutzutage nach Ansicht Kaserers durch das Herdenverhalten der institutionellen Anleger. Sie müssen sich immer mehr an führenden Indizes (Benchmarks) orientieren und können immer weniger eigene Akzente in der Anlagepolitik setzen.
Am Anfang des Abschwungs haben dabei häufig externe Schocks eine Rolle gespielt, der Zusammenbruch des Hedge Funds LTCM 1998 oder die Ölkrise 1972. Olaf Stotz vom Institut für Asset Management an der Uni Aachen weist auf einen weiteren Unterschied hin: den gegenwärtigen Vertrauensverlust in das Finanzsystem nach zahlreichen Bilanz- und Analystenskandalen.
Ihm scheint die aktuelle Situation mit dem Crash in Japan 1990 vergleichbar. Auch die Deutsche Bank sieht in einer Studie Gemeinsamkeiten zu heute: "Aktienmärkte, BIP-Wachstum, Investitionen, Inflation und Verlangsamung des Kreditwachstums - alles dies entwickelt sich ähnlich wie seinerzeit in Japan."
Gier geht dem Absturz voraus
Abstürze an den Märkten sind keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts. Als erster Crash gilt die Tulpenkrise in den Niederlanden 1636. Es folgten der Eisenbahn-Crash in Großbritannien ab 1845, oder der Absturz nach dem Gründerboom in Deutschland 1873. Häufig führt eine neue Technologie - vor 1845 die Eisenbahn, vor 1929 das Automobil, vor 2000 das Internet - zu einem kräftigen Wachstum, das bald in Übertreibung umschlägt. "Letztendlich ist die Gier der Anleger die Erklärung", sagt Stotz.
Typisch seien ein Gründerboom, kräftig wachsender privater Konsum und Korruption, erläutert der Wissenschaftler Charles Kindleberger. Darüber hinaus setze sich das Gefühl durch, eine neue Ära sei angebrochen. Regeln zur Dauer einer Krise bietet die Geschichte nicht. Fest steht nur, dass eine Bankenkrise im Anschluss an den Börsenabsturz die Probleme verschärft. Sollte jetzt ein großes Finanzinstitut zusammenbrechen, "wird das psychologisch sehr schwierig", sagt Kaserer.
Aus dem Verlauf früherer Crashs Rückschlüsse auf die heutige Situation abzuleiten, hält Joachim Goldberg für fragwürdig. Seine Firma Cognitrend hat sich auf die Untersuchung des Anlegerverhaltens spezialisiert. Grundsätzliche Muster ähnelten sich, doch die Rahmenbedingungen seien immer wieder andere. "Blasen sind schon häufig geplatzt, aber jeder Fall ist doch singulär", sagt Goldberg. Dass dennoch immer wieder Vergleiche angestellt werden, "liegt in der menschlichen Psyche begründet". "Wir suchen Erklärungen, um die Lage unter Kontrolle zu halten."
ftd.de
Gruß
Happy End