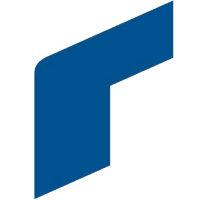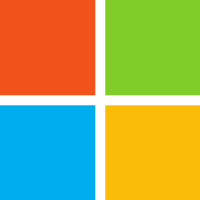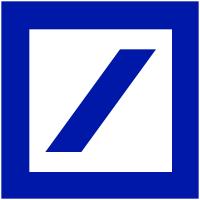Nach sechzehn langen Jahren konservativ-liberaler Koalition entschloss sich der bundesdeutsche Wähler im September 1998 zum ersten Mal, eine amtierende Bundesregierung abzuwählen. Dass es sich hierbei um eine politische Richtungsentscheidung gehandelt haben könnte, ist freilich eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass man ganz einfach nur des politischen Personals überdrüssig geworden war. Ganz sicher galt dies für die führenden Vertreter der deutschen Industrie- und Bankenwelt: Unter dem dämpfenden Einfluss einer konservativen Volkspartei waren einschneidende "Reformen" seit längerer Zeit nicht mehr recht vom Fleck gekommen. Wollte man in der vorgegebenen Richtung weiterkommen (Race to the Bottom!), musste Personal angeheuert werden, das zukünftige Zumutungen glaubhaft und mit Überzeugung an die Wählerschaft verkaufen konnte. Sozialdemokraten und Grüne, seit Jahren auf der Reservebank schmachtend, waren heiß auf den Job. Gerhard Schröder, zukünftiger Bundeskanzler aller deutschen Autos, musste nur eben noch schnell seine sozial-ökologisch engagierte Frau entsorgen, was ihm mit Unterstützung der Boulevard-Presse und einer Currywurst-Story auch reibungsarm gelang. Bald darauf, mit einer FOCUS-Redakteurin verkuppelt, war er reif für das Kanzleramt. Josef Fischer und seine realpolitische Kamarilla distanzierten sich gerade noch rechtzeitig vor der Wahl von einer ökologische Steuerreform, die bei den Besitzern der deutschen Autos möglicherweise zu Verunsicherung geführt hätte.
Nach der nicht zu umgehenden Einlösung einiger Wahlversprechen (Lohnfortzahlung, Renten) entledigte man sich bei erster Gelegenheit des unbequemen, keynesianisch-makroökonomisch angehauchten, Finanzministers Lafontaine, ersetzte ihn durch die Büroklammer (schwäbisch: Entenklemmer) Eichel und verabschiedete ein Sparpaket wie aus dem monetaristischen Bilderbuch. Zwischenzeitlich hatte man auch die Rentner wieder als Einsparpotential entdeckt und bastelte an Rentenkürzungen, die in der CDU/CSU auf erbitterten Widerstand gestoßen wären. Ersparen wir uns weitere unerquickliche Einzelheiten...
Politikwechsel?
Zahlreiche Kritiker stellen sich nun die Frage, ob es seit September 98 überhaupt einen politischen Richtungswechsel gegeben hat. Der Wechsel vom reinen Neoliberalismus zum sogenannten "Dritten Weg" (Giddens/Blair) oder der "Neuen Mitte" (Beck/Hombach/Schröder) ist jedoch in der Tat ein Politikwechsel. Dies bezieht sich jedoch nicht auf die Ziele sondern auf die Methoden der neuen Regierung. Dass es für die Masse der Lohnabhängigen, die Arbeitslosen und die Rentner auch in Zukunft nur darum gehen kann, den Gürtel immer enger zu schnallen, darin sind sich der "Dritte Weg" und der Neoliberalismus einig. Nicht einig sind sie sich, wie diese "Angebotspolitik von links" (ein hölzernes Eisen) in der Gesellschaft vermittelt und moderiert werden soll. Soziologischen Untersuchungen zufolge sind in den westlichen Industrieländern mittlerweile 30 bis 40% der Bevölkerung de facto Angehörige der Unterschicht! Wie kann man eine Gesellschaft vor dem Auseinanderfallen bewahren, in der die sozialen Unterschiede dermaßen schnell zunehmen? Das Rezept des "Dritten Weges" heißt daher Integration, Einbindung, Bündnispolitik statt schlichter Konfrontation:
Der vom "Dritten Weg" angestrebte Niedriglohnsektor z.B. ist ein Versuch, die neue Unterschicht wieder in das Arbeitsleben und die gesellschaftlichen Strukturen zu integrieren.
Das "Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit" (!) ist der Versuch, die Gewerkschaften langfristig in eine nationale Wettbewerbspolitik einzubinden.
Dem gleichen Ziel dienen Bündnisse und Vereinbarungen zwischen Betriebsräten und Geschäftsleitungen auf Firmenebene. "Weg von der Straße und rein in die Verhandlungszimmer" heißt die Parole.
Neokorporativismus
Die Schaffung derartiger Strukturen auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft ergibt in der Praxis eine Art Neokorporativismus, Neo- deshalb, weil das Verhältnis von Arbeit und Kapital nicht mehr wie früher gleichwertig, sondern differenziert gesehen wird. Gleichwohl sollen nach den Vorstellungen des "Dritten Weges" gesellschaftliche Auseinandersetzungen in geordneten, formal paritätischen Strukturen auf dem Wege des Konsenses geregelt werden.
Kommunitarismus
In den Zusammenhang des "Dritten Weges" gehört, der Vollständigkeit halber, auch die Kommunitarismus-Diskussion. Der Kommunitarismus ist eine Bewegung aus den USA, die sozialstaatliche Strukturen (institutionalisierte Solidarität) durch "bürgerliches Engagement" (Bürgerarbeit, Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe, Selbsthilfegruppen, freiwillige Solidarität) ersetzen will. Es ist klar, dass in Zeiten geplünderter Sozialkassen Bestrebungen Konjunktur haben, die bezahlte Hilfeleistung im Rahmen staatlich-kommunaler Einrichtungen in unbezahlte Hilfeleistung von Bürgerorganisationen umwandeln möchten. Nichtsdestoweniger sind kommunitaristische Bestrebungen Bestandteil einer Strategie der Einbindung und Integration in lokale bürgerschaftliche Zusammenhänge.
Der Dritte Weg
Dass in diesem Papier die Begriffe "Dritter Weg" und "Neue Mitte" stets in Anführungszeichen verwendet werden, bedarf einer kurzen Erklärung. Der Begriff des Dritten Weges hatte in der Diskussion innerhalb der Sozialdemokratie von jeher eine andere Bedeutung. Dritter Weg meinte einen Mittelweg zwischen Staatssozialismus und Kapitalismus. So wurde der Begriff seit Jahrzehnten verwendet und diskutiert. Die "soziale Marktwirtschaft" und der fordistisch-keynesianische Sozialstaat wurde von manchen Optimisten als dieser Dritte Weg angesehen.
Der "Dritte Weg" in seiner "neuen" Bedeutung meint einen Mittelweg zwischen Sozialstaat und Wettbewerbsstaat, zwischen alter Sozialdemokratie und Liberalismus. Die Bedeutung des Begriffes hat sich also im politischen Spektrum deutlich nach rechts verschoben.
Die Neue Mitte
Der Begriff "Neue Mitte" ist ein Pudding, der sich schwer an die Wand nageln lässt - nicht unähnlich seinen Propagandisten Bodo Hombach und Gerhard Schröder. Er wurde eigens zu dem Zweck geprägt, in den Augen des Wahlvolkes jeden Verdacht einer linken Restidentität der SPD auszuräumen. Die SPD sollte wahlpsychologisch dort positioniert werden, wo seither Union und FDP angesiedelt waren: in der systemstabilisierenden Mitte. Rechtzeitig vor der Wahl wurde von Schröder die Parole ausgegeben, dass es weder eine linke noch eine rechte Wirtschaftspolitik geben könne, sondern nur eine moderne oder eine unmoderne. Wie man heute weiß, meinte Schröder was er sagte und wurde prompt gewählt. Die Deutschen lieben eben Überzeugungstäter...
Eine zweite, soziologische Bedeutung der "Neuen Mitte" bezieht sich auf eine "neue Mittelschicht", die sich im Zuge der Modernisierungs- und Ausleseprozesse unter den Bedingungen von Globalisierung und Standortwettbewerb herausgebildet hat. Schröders Wahlkampfstrategie zielte darauf ab, diese arrivierte Schicht von Modernisierungsgewinnern zu umwerben, da die Modernisierungsverlierer (z.B. Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger) ohnehin nicht mehr wählen gehen und die unteren Schichten gar keine andere Wahl haben, als die SPD zu wählen.
Das bedeutet in der Praxis, das sich die "Neue Mitte" der Sozialdemokratie in weiten Bereichen mit den "Besserverdienenden" der FDP deckt. Die Vertreter der "Neuen Mitte" verstehen sich somit keinesfalls mehr als Anwälte und Interessenvertreter der "kleinen Leute". Auch hier ist also politisch ein deutlicher Rechtsruck zu verzeichnen.
Konservativismus mit Herz
Führende Konservative wie Heiner Geißler und Wolfgang Schäuble haben erkannt, dass ihre Wahlniederlage vom September 98 nicht ihrer Wirtschafts- oder Finanzpolitik zu verdanken war, sondern vielmehr dem Unvermögen, diese Politik im Rahmen eines gesellschaftlichen Konsensmodells (Bündnis für Arbeit usw.) abzusichern. Gleichzeitig hallt über den Atlantik die Parole eines George W. Bush, der einen compassionate conservatism, einen "Konservativismus mit Herz" propagiert, um im Jahr 2000 die Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Seine Chancen stehen gut - besonders nachdem John F. Kennedy jr. unter merkwürdigsten Umständen vom Himmel über der amerikanischen Ostküste gefallen ist. Ein Schelm, wer böses dabei denkt...
Es ist damit zu rechnen, dass die Parole des "Konservativismus mit Herz" auch bei den deutschen und europäischen Konservativen Widerhall finden wird, so wie Blairs "New Labour" bei den Sozialdemokraten eingeschlagen hat. Wenn die Schröder-Fischer-Koalition an ihrer Aufgabe, den Wähler zu verarschen ohne ihn zu verärgern, scheitert, schlägt die Stunde eines geläuterten Neokonservativismus voller Mitgefühl und sozialer Verantwortung. Ein schöner Vorgeschmack sind die aktuellen CDU-Kampagnen gegen Rentenbeschlüsse und Sparpaket: Die SPD ist auf ihrem Weg in die "Neue Mitte" so weit nach rechts gerutscht, dass sie von der CDU mühelos links überholt werden kann...
Laptop und Lederhose
Eine andere Variante konservativer Politik ist der Wettbewerbs-Föderalismus von Landesfürsten wie Kurt Biedenkopf und Edmund Stoiber. Unter Föderalismus versteht man die Betonung der Eigenständigkeit von einzelnen Bundesländern bzw. Regionen im Rahmen eines Bundesstaates (BRD) bzw. Staatenbundes (EG). Biedenkopf und Stoiber gehen davon aus, dass der Globalisierung des Wettbewerbs am besten durch eine Regionalisierung der Wirtschaftsräume zu begegnen ist. Das heißt, dass sich einzelne Länder - wie etwa Sachsen, Bayern oder Baden-Württemberg - besser im Wettbewerb behaupten können, als ganze Staaten, die ja auch über weniger leistungsfähige Regionen verfügen. Folgerichtig sollen die starken Regionen bzw. Bundesländer ihre Mittel und Ressourcen im Lande halten, statt sie über Solidarpakte wie etwa den Länderfinanzausgleich mit schwächeren Partnern zu teilen. Soviel zum Laptop...
Die Lederhose symbolisiert die hierfür erforderliche regionale Identitäts- und Traditionspflege. Wenn man solchermaßen "allein gegen den Rest der Welt" sein Heil erlangen will, muss man sich wenigstens der Vortrefflichkeit und Einmaligkeit seiner Heimatregion versichern. Ein starkes Wir-Gefühl, verbunden mit ein wenig bodenständiger Fremdenfeindlichkeit und eine rege Brauchtumspflege sind hierfür nützlich und notwendig.
Gewerkschaften
Wir haben uns nunmehr einen groben Überblick über die Entwicklung unseres Wirtschaftssystems seit dem zweiten Weltkrieg bis heute verschafft. Wir haben gesehen, dass - bezogen auf Westeuropa - ein Vierteljahrhundert relativer Prosperität (Fordismus) Mitte der 70er-Jahre in eine Phase wirtschaftlicher Stagnation und zunehmender Massenarbeitslosigkeit mündete (Krise des Fordismus).
Während der fordistischen Phase (ca. 1948 bis 1973) war es den abhängig Beschäftigten mit ihren Gewerkschaften gelungen, ein bislang unbekanntes Maß an sozialer Sicherheit und Wohlstand zu erzielen. Mit dem Einsetzen der strukturellen Überakkumulation Mitte der 70er-Jahre zeigte sich jedoch, dass diese Sicherheit nur eine relative und zeitlich beschränkte war. Seit es notwendig wurde, von diesen Sicherheiten Gebrauch zu machen, werden sie Schritt für Schritt in einem langen Prozess des Sozialabbaus wieder zurückgenommen. Die herrschenden Schichten der westlichen Industriegesellschaften zeigen einer verdutzten und handlungsunfähigen Arbeitnehmerschaft, was "Sicherheiten" in einer konkurrenzgesteuerten Marktwirtschaft wert sind.
Was bedeutet nun diese Situation für die Gewerkschaften?
Nach dem zweiten Weltkrieg führten die Bedingungen der fordistischen Produktionsweise dazu, dass sich in den Industriebetrieben sozial homogene (gleichartige) Belegschaften herausbildeten. Damit ist gemeint, dass der Typ des alleinverdienenden männlichen Vollzeitbeschäftigten mit Familie der vorherrschende Arbeitnehmertyp war. Das System der Flächentarifverträge sorgte erfolgreich für vergleichbare Arbeitsbedingungen und Entgelte. Dies hatte zur Folge, dass die Beschäftigten weitgehend gleiche Interessen und Denkweisen an den Tag legten. Dies, und der Umstand, dass zeitweise sogar Arbeitskräftemangel herrschte, die Beschäftigten also kaum Angst um ihren Arbeitsplatz haben mussten, erleichterte den Gewerkschaften die Organisation und Durchsetzung der Arbeitnehmerinteressen.
Mit dem Strukturbruch der 70er-Jahre gerieten die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften in eine neue und sehr viel schwierigere Lage. Genau genommen war es gar keine "neue" Lage, sondern der schlechte alte Kapitalismus vor den goldenen Jahren der Prosperität hatte sie einfach wieder eingeholt. Das Ungeheuer, das man staatsinterventionistisch und tarifvertraglich gezähmt und an die Leine gelegt zu haben glaubte, befreite sich mit Leichtigkeit von seinen Ketten und verbreitete auf einmal wieder Angst und Schrecken. Mit der zunehmenden Massenarbeitslosigkeit und den zahlreichen neuen und prekären (unsicheren, befristeten) Beschäftigungsformen (Zeitverträge, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit, geringfügige Beschäftigung etc.) verwandelten sich die einst homogenen und geschlossenen Belegschaften in sozial differenzierte und disparate (ungleiche). Die gemeinsamen Interessen wichen teilweise gegensätzlichen und widersprüchlichen Haltungen. Aus solidarischen Arbeitskollegen wurden konkurrierende "Unternehmer ihres eigenen Humankapitals" (vulgo: Arbeitskraft). Die Ellenbogen- und Risikogesellschaft (Ulrich Beck) hatte sich durchgesetzt. Inkonsistente (widersprüchliche) Soziallagen führten zu weiterer Verunsicherung der Arbeitnehmer. Welch ein Bewusstsein seiner Lage soll ein abhängig Beschäftigter entwickeln, der in seiner freien Zeit im Fernsehen Börsensendungen glotzt und sein mühsam erarbeitetes Salär dem Aktienmarkt in den Rachen wirft? Tagsüber kleiner Grupper, abends kleiner Couponschneider - eine galoppierende Schizophrenie ist nichts dagegen...
Für die Gewerkschaften ist diese Situation schwierig. Wenn Beitragszahler zu Arbeitslosen werden, Kollegen zu Konkurrenten, Angestellte zu Scheinselbständigen, dann schwächt jede dieser Entwicklungen die Organisations- und Kampfkraft. Das ist beabsichtigt: Egal, ob die Gewerkschaften unterworfen (Liberalismus) oder eingebunden (Neokorporatismus) werden sollen, für das Kapital ist nur eine schwache Gewerkschaft eine gute Gewerkschaft. Die erste und eigentliche Raison d'etre (Daseinsgrund) der Gewerkschaften, die Konkurrenz unter den Arbeitenden aufzuheben und in Solidarität zu verwandeln, hat in einer Wettbewerbsgesellschaft keine Daseinsberechtigung.
Es besteht Grund zu der Annahme, dass sich die strukturelle Überakkumulationskrise und die weltweit existierenden Überkapazitäten weiter verschärfen werden. Als Ende der 20er-Jahren unseres Jahrhunderts eine ähnliche Situation schon einmal bestand, brauchte es einen Aufrüstungsboom und einen zweiten Weltkrieg, um den Prozess der Kapitalvernichtung so weit voranzutreiben, dass anschließend für ein Vierteljahrhundert wieder einträgliche Realakkumulation möglich war. Einen solchen Ausweg aus der Krise sollten wir uns dann vielleicht doch nicht noch mal wünschen. Der von Klaus Peter Kisker diagnostizierte Strukturbruch bedeutet nichts anderes, als dass unser vielgelobtes und ach so konkurrenzloses Wirtschaftssystem wieder einmal seine Systemgrenze erreicht hat und sozusagen am Anschlag operiert. Das System kann materiellen Reichtum erzeugen, darin ist es immer erfolgreich gewesen, aber es kann von sich aus diesen Reichtum nicht verteilen, dazu muss es immer gezwungen werden. Bleibt dieser Zwang aus, und die Regierungen der westlichen Industriestaaten haben nicht vor, dem Kapital die Instrumente zu zeigen, dann geraten wir in eine Situation fortgesetzten Durchwurstelns ohne Aussicht auf Besserung - angestrengtes Sich-abarbeiten am harten Anschlag der Systemgrenze...
Was können nun die Gewerkschaften tun, um aus ihrer langanhaltenden Defensive herauszukommen?
Zuerst einmal sollten wir uns vor Augen halten, dass der Organisationsgrad der deutschen Gewerkschaften im internationalen Vergleich verhältnismäßig hoch ist. 1995 waren in der BRD 29% aller Beschäftigten gewerkschaftlich organisiert. In den USA waren es 13%, in Frankreich 9%. Wir sind zwar geschwächt, aber schwach sind wir noch lange nicht...
Zum zweiten müssen wir erkennen, dass mit dem Rechtsruck der Sozialdemokratie die politische Vertretung der gesamten arbeitenden Bevölkerung plus Rentner und Arbeitslose nur noch von den Gewerkschaften wahrgenommen werden kann. Das bedeutet, dass sich die Gewerkschaften, ihre Funktionäre und Mitglieder als politische Vordenker und Akteure verstehen und bewähren müssen! Die Gewerkschaften haben keine andere Wahl mehr: Sie müssen sich politisieren, sie müssen ihr politisches Mandat wahrnehmen! Der Sozialstaat muss von den Gewerkschaften mit Zähnen und Klauen verteidigt werden, verlorenes Terrain muss mit allen Mitteln zurückerobert werden. Das Vokabular ist kriegerisch, denn das Kapital führt einen schonungslosen Klassenkampf von oben!
Dies wiederum setzt die politische und ökonomische Ausbildung und Weiterbildung der Gewerkschafter auf allen Ebenen der Organisation voraus. Es kann und darf in den Gewerkschaften kein "Recht auf Dummheit und Ignoranz" geben. Die politische Bildung darf sich nicht mehr, wie in der Vergangenheit, auf die Belange der innerbetrieblichen Mitbestimmung beschränken. Das Tätigkeitsfeld der Gewerkschaften ist die gesamte Gesellschaft mit allen ihren sozialen, politischen und ökonomischen Belangen.
Wir müssen einen Kampf führen um die Herzen und Köpfe unserer Kollegen und Mitbürger. "Gewerkschaft" muss im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gleichbedeutend werden mit "sozialer Kompetenz, politischem Einfallsreichtum und ökonomischem Sachverstand". Die gewerkschaftlichen Führungszirkel müssen lernen, auf dem Klavier der alten und neuen Medien zu spielen. Wenn einmal klar wäre, dass vernünftige und zukunftsweisende Vorschläge und Forderungen nur noch von den Gewerkschaften zu erwarten sind, bräuchten wir uns um unsere Mitgliederentwicklung keine Sorgen mehr machen...
Die Gewerkschaften müssen lernen, dass Gesellschaftspolitik nicht darin bestehen kann, nur Forderungen zu formulieren, die über einen Arbeitskampf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchgesetzt werden können. Eine Forderung kann auch dann, und gerade dann, sinnvoll sein, wenn sie unter den gegebenen Verhältnissen nicht oder noch nicht durchzusetzen ist. Politik muss bestimmen und an die Öffentlichkeit bringen was wünschenswert und notwendig ist, sie muss Denkgewohnheiten aufbrechen und Gefühle mobilisieren. "Durchsetzbarkeit" ist eine Frage der Zeit und des langen Atems...
 home.t-online.de/home/newway/konzyk2.gif" style="max-width:560px" >
home.t-online.de/home/newway/konzyk2.gif" style="max-width:560px" > home.t-online.de/home/newway/iddowb.gif" style="max-width:560px" >
home.t-online.de/home/newway/iddowb.gif" style="max-width:560px" > home.t-online.de/home/newway/dow01b.gif" style="max-width:560px" >
home.t-online.de/home/newway/dow01b.gif" style="max-width:560px" >