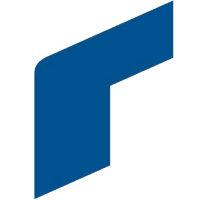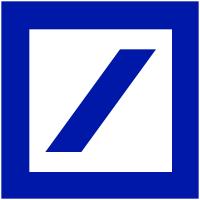Er wurde gehasst und geliebt, erlaubt und verboten: Eine kleine Geschichte des Zinses
Von Peter Müller
Im Jahr 1932 sah es düster aus in Wörgl am Inn. Hohe Arbeitslosigkeit und dramatische Verschuldung plagten das österreichische 4200-Einwohner-Dorf, als Michael Unterguggenberger, „der Bürgermeister mit dem langen Namen“, wie ihn der US-Ökonom Irving Fisher später nennen sollte, sein Amt antrat. In dieser Situation schlug Unterguggenberger dem Gemeinderat vor, ein Geldexperiment auszuprobieren, das der in Belgien geborene Ökonom Silvio Gesell 1916 in seiner Natürlichen Wirtschaftsordnung beschrieben hatte.
In einem Nothilfeprogramm wurde beschlossen, das „Wörgler Freigeld“ einzuführen, so genannte Arbeitswertscheine, die durch Wechsel und Schillinge gedeckt waren. Dieses neue Geld hatte eine Besonderheit: Derjenige, der Freigeld über längere Zeit auf der Bank ansammelte, bezog keine Zinsen. Vielmehr musste er am Ende jedes Monats eine Benutzungsgebühr entrichten. Ein Negativzins, wenn man so will, der den bestrafte, der Geld hortete.
Das Ergebnis des dörflichen Experiments konnte sich sehen lassen: Der Anreiz, das Freigeld möglichst schnell wieder auszugeben, führte zu raschem Geldumlauf. Hohe Investitionen bewirkten, dass die Arbeitslosigkeit um ein Viertel sank, während sie andernorts weiter anstieg. Durch die Benutzungsgebühr verbuchte die Stadt Einnahmen in Höhe von zwölf Prozent des ausgegebenen Freigeldes. Sogar eine Skischanze konnte sie sich leisten. Als jedoch die Nachbargemeinde Kirchbichl dem Beispiel folgen wollte, wurde die Notenbank unruhig und beendete vor dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof den Versuch, auf den Zins zu verzichten.
Das Experiment von Wörgl wird auch heute noch gern von denen angeführt, die von einer zinslosen Gesellschaft träumen. Denn der Zins polarisiert. Christen und Juden hatten seine Erhebung verboten. Klassiker und Keynesianer versuchten, ihm auf den Grund zu gehen. Marxisten und Sozialisten forderten seine Abschaffung. Notenbanker und Politiker stritten um seine Höhe, Adenauer benutzte gar das Bild des Fallbeils, mit dem die Bundesbank die Konjunktur erschlage. Dabei sind die Fragen, die den Zins umranken, so alt wie das Phänomen selbst: Woher kommt er, und warum gibt es ihn überhaupt? Und: Wie ist, um mit dem österreichischen Kapitaltheoretiker Eugen von Böhm-Bawek zu sprechen, der „moralische Schatten“ zu erklären, der dem Zins bis heute anhaftet?
„Gelderwerb gegen die Natur“
Rolle rückwärts, in die Stadt Athen, in die Zeit des Aristoteles. Der Philosoph, der der Ökonomie ihren Namen gab, hat auch die Geschichte des Zinses entscheidend bestimmt. „Das Geborene ist gleicher Art wie das Gebärende, und durch den Zins entsteht Geld aus Geld. Diese Art des Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur.“ Aristoteles’ Argument von der Unfruchtbarkeit des Geldes ist der Hauptgrund, warum die Geschichte des Zinses zu einer Geschichte seines Verbotes wird.
Thomas von Aquin sorgte dafür, dass aus dem aristotelischen das kanonische Zinsverbot wurde und berief sich dabei nicht nur auf die Bibel: „Wenn du (einem aus) meinem Volke Geld leihst, einem Armen neben dir, so handle an ihm nicht wie ein Wucherer; ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen“, heißt es im 2. Buch Mose. Thomas fasste den Zins, durchaus modern, als Preis für Zeit auf, genauer, als Preis für die Zeit, die der Verleiher auf sein Geld verzichte. Zeit jedoch sei ein Geschenk Gottes, so der Kirchenrechtler, und dürfe nicht verkauft werden. Zudem könne Gewinn durch die Hingabe von Geld nur zulasten des Vermögens anderer erzielt werden. Der gute Christ aber verdiene sein Geld mit Arbeit.
Praktische Erwägungen stärkten das kanonische Zinsverbot. Das Hochmittelalter war keine Zeit des Fortschritts, die Bevölkerungszahlen stagnierten, bahnbrechende Erfindungen blieben aus. In diesem Umfeld dienten Kredite nicht der wirtschaftlichen Expansion, sondern der Überbrückung von Notzeiten. Dafür sollte Kapital kostenlos zu haben sein.
Nichts als Diebe, Räuber und Mörder seien Zinsnehmer für ihn, wetterte Martin Luther, als er die Reformation ihrem Höhepunkt entgegentrieb. Ein gutes Jahrhundert später setzte William Shakespeare dem Wucherer mit dem rachsüchtigen Shylock in Der Kaufmann von Venedig ein umstrittenes literarisches Denkmal.
Doch im 17. Jahrhundert begann mit wirtschaftlichem Aufschwung der Pragmatismus zu obsiegen. Flanderns aufstrebende Handelsstädte ließen sich in ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsfreiheit nicht durch Verbote aus antiken Zeiten einengen. Weltliches Wachstum erforderte finanzielle Ressourcen. Dafür war man bereit zu zahlen. Überregional organisierte Kreditmärkte entstanden. Die Amsterdamer Börse wurde gegründet.
Der Zins überdauerte nicht nur das kanonische Verbot, welches Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich aufgehoben wurde. Er überstand auch die Planwirtschaft sowjetischen Zuschnitts und die verquasten Ideen der Nationalsozialisten von einer völkisch motivierten Solidargemeinschaft.
Im Islam sind Aufschläge tabu
Marx sah im Privateigentum an Produktionsmitteln die Quelle der Ausbeutung des Arbeiters. Im Zins, der Bestandteil des Mehrwerts sei, werde dem Arbeiter ein Teil seines Arbeitsertrages vorenthalten. Im real existierenden Sozialismus war der Zins denn auch folgerichtig abgeschafft, offiziell wenigstens. In der Praxis merkte man schon bald, dass man auf seine Steuerungsfunktion bei der Allokation von Geldern nicht verzichten konnte. In der DDR führte Walter Ulbricht den Zins Anfang der sechziger Jahre wieder ein. Im Rahmen des „Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung“, kurz NÖSPL, hieß er nun Produktionsfondsabgabe. Unternehmen hatten dem Staat zwangsweise Kredite abzunehmen und mussten diesen nicht nur mit Teilen ihrer Gewinne, sondern auch durch die Zahlung von Zinsen alimentieren.
Bei den Nationalsozialisten war die Forderung, die „Zinsknechtschaft des Geldes“ zu brechen, fester Bestandteil des Parteiprogramms. Um die Industriebosse an Rhein und Ruhr zu beruhigen, wusste man ideologisch freilich zwischen „schaffendem“ Industriekapital und „raffendem“ Finanzkapital zu unterscheiden. Letzteres bezeichnete als Synonym jüdische Bankiers, die als Sündenbock für Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit dienten.
In der islamischen Gesellschaft gilt der Zins auch heute noch als Fremdkörper. „Und was immer ihr an Riba verleiht, damit es sich mit dem Gut der Menschen mehre, es vermehrt sich nicht vor Allah“; offenbarte der Prophet in Mekka, 622 nach Christus (Sure 30:39). Riba heißt so viel wie ungerechtfertigte Bereicherung und schließt den Zins – bezeichnenderweise – mit ein. Darlehen würden aus Solidarität vergeben, so die Lehre des Islam, nicht aus Profitgier. Geld sei zudem nur als Bote (Tauschmittel) und Richter (Wertmesser) tauglich und dürfe nicht durch Zurückhalten und Verleihen zweckentfremdet werden.
Die moralische Verdammung des Zinses durch die Jahrhunderte beantwortet freilich nicht die Frage, warum es den Zins überhaupt gibt, sondern fordert sie gerade heraus. Warum muss man mehr Geld zurückzahlen, als man bekommen hat, obwohl Geld nicht abgenutzt wird?
Die Frage geht an Hans-Christoph Binswanger, einem emeritierten Professor für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen. Der Mann hat ein Buch über Zins und Gewinn verfasst (Geld und Wachstum) und kann die einzelnen Theorien, die sich um das Phänomen Zins ranken, schnell runterbeten, allerdings nicht, ohne auch gleichzeitig in ihre Kritik einzusteigen.
Für die Klassiker, wie Adam Smith, ist der Zins ein Teil des Profits, den der Schuldner mithilfe von Produktionsmitteln erworben hatte, die durch Kredite finanziert worden waren. Dieser stand nun dem Gläubiger zu. Klingt plausibel und auch Binswanger sagt diese Theorie noch am ehesten zu. Ihr Schönheitsfehler jedoch: Auch derjenige Schuldner hat Zinsen zu entrichten, der keinen Gewinn macht.
Die Neoklassiker wollen den Entleiher belohnen, der auf seinen gegenwärtigen Konsum zugunsten des Schuldners verzichtet. „Man kann aber auch aus anderen Gründen auf Konsum verzichten als nur wegen Zinsen“, sagt Binswanger, „zum Beispiel, um fürs Alter zu sparen.“
Also, zur Seite damit, und das Blickfeld frei für John Maynard Keynes. Der US-Ökonom spricht von Zins als Liquiditätsprämie, die Menschen für die Annehmlichkeit und Sicherheit, die Geld bietet, zu zahlen bereit seien. Geben sie diese Annehmlichkeit auf, verlangen sie nach einer Belohnung – dem Zins. Binswanger freilich überzeugt der Grundgedanke, wonach es eine Prämie für gehaltenes Geld gäbe, nicht: „Wegen der Tatsache allein, dass ich Geld nur halte, kriege ich noch gar nichts.“
Ernüchterndes Ergebnis der Nachfrage: Ökonomen können die Höhe von Zinsen zwar recht einfach berechnen, indem sie einem vom Schuldner abhängigen Risikozuschlag zur Inflation addieren, die sie für die Dauer des Darlehens erwarten. Aber, so Binswanger: „Die Frage, warum es Zinsen gibt, hat die Ökonomie bis heute nicht gelöst. Dies ist eine moralische Frage, die der Ökonom nicht los wird.“ Womit wir beim Anfang wären.
Von Peter Müller
Im Jahr 1932 sah es düster aus in Wörgl am Inn. Hohe Arbeitslosigkeit und dramatische Verschuldung plagten das österreichische 4200-Einwohner-Dorf, als Michael Unterguggenberger, „der Bürgermeister mit dem langen Namen“, wie ihn der US-Ökonom Irving Fisher später nennen sollte, sein Amt antrat. In dieser Situation schlug Unterguggenberger dem Gemeinderat vor, ein Geldexperiment auszuprobieren, das der in Belgien geborene Ökonom Silvio Gesell 1916 in seiner Natürlichen Wirtschaftsordnung beschrieben hatte.
In einem Nothilfeprogramm wurde beschlossen, das „Wörgler Freigeld“ einzuführen, so genannte Arbeitswertscheine, die durch Wechsel und Schillinge gedeckt waren. Dieses neue Geld hatte eine Besonderheit: Derjenige, der Freigeld über längere Zeit auf der Bank ansammelte, bezog keine Zinsen. Vielmehr musste er am Ende jedes Monats eine Benutzungsgebühr entrichten. Ein Negativzins, wenn man so will, der den bestrafte, der Geld hortete.
Das Ergebnis des dörflichen Experiments konnte sich sehen lassen: Der Anreiz, das Freigeld möglichst schnell wieder auszugeben, führte zu raschem Geldumlauf. Hohe Investitionen bewirkten, dass die Arbeitslosigkeit um ein Viertel sank, während sie andernorts weiter anstieg. Durch die Benutzungsgebühr verbuchte die Stadt Einnahmen in Höhe von zwölf Prozent des ausgegebenen Freigeldes. Sogar eine Skischanze konnte sie sich leisten. Als jedoch die Nachbargemeinde Kirchbichl dem Beispiel folgen wollte, wurde die Notenbank unruhig und beendete vor dem österreichischen Verwaltungsgerichtshof den Versuch, auf den Zins zu verzichten.
Das Experiment von Wörgl wird auch heute noch gern von denen angeführt, die von einer zinslosen Gesellschaft träumen. Denn der Zins polarisiert. Christen und Juden hatten seine Erhebung verboten. Klassiker und Keynesianer versuchten, ihm auf den Grund zu gehen. Marxisten und Sozialisten forderten seine Abschaffung. Notenbanker und Politiker stritten um seine Höhe, Adenauer benutzte gar das Bild des Fallbeils, mit dem die Bundesbank die Konjunktur erschlage. Dabei sind die Fragen, die den Zins umranken, so alt wie das Phänomen selbst: Woher kommt er, und warum gibt es ihn überhaupt? Und: Wie ist, um mit dem österreichischen Kapitaltheoretiker Eugen von Böhm-Bawek zu sprechen, der „moralische Schatten“ zu erklären, der dem Zins bis heute anhaftet?
„Gelderwerb gegen die Natur“
Rolle rückwärts, in die Stadt Athen, in die Zeit des Aristoteles. Der Philosoph, der der Ökonomie ihren Namen gab, hat auch die Geschichte des Zinses entscheidend bestimmt. „Das Geborene ist gleicher Art wie das Gebärende, und durch den Zins entsteht Geld aus Geld. Diese Art des Gelderwerbs ist also am meisten gegen die Natur.“ Aristoteles’ Argument von der Unfruchtbarkeit des Geldes ist der Hauptgrund, warum die Geschichte des Zinses zu einer Geschichte seines Verbotes wird.
Thomas von Aquin sorgte dafür, dass aus dem aristotelischen das kanonische Zinsverbot wurde und berief sich dabei nicht nur auf die Bibel: „Wenn du (einem aus) meinem Volke Geld leihst, einem Armen neben dir, so handle an ihm nicht wie ein Wucherer; ihr sollt ihm keinen Zins auferlegen“, heißt es im 2. Buch Mose. Thomas fasste den Zins, durchaus modern, als Preis für Zeit auf, genauer, als Preis für die Zeit, die der Verleiher auf sein Geld verzichte. Zeit jedoch sei ein Geschenk Gottes, so der Kirchenrechtler, und dürfe nicht verkauft werden. Zudem könne Gewinn durch die Hingabe von Geld nur zulasten des Vermögens anderer erzielt werden. Der gute Christ aber verdiene sein Geld mit Arbeit.
Praktische Erwägungen stärkten das kanonische Zinsverbot. Das Hochmittelalter war keine Zeit des Fortschritts, die Bevölkerungszahlen stagnierten, bahnbrechende Erfindungen blieben aus. In diesem Umfeld dienten Kredite nicht der wirtschaftlichen Expansion, sondern der Überbrückung von Notzeiten. Dafür sollte Kapital kostenlos zu haben sein.
Nichts als Diebe, Räuber und Mörder seien Zinsnehmer für ihn, wetterte Martin Luther, als er die Reformation ihrem Höhepunkt entgegentrieb. Ein gutes Jahrhundert später setzte William Shakespeare dem Wucherer mit dem rachsüchtigen Shylock in Der Kaufmann von Venedig ein umstrittenes literarisches Denkmal.
Doch im 17. Jahrhundert begann mit wirtschaftlichem Aufschwung der Pragmatismus zu obsiegen. Flanderns aufstrebende Handelsstädte ließen sich in ihrer wirtschaftlichen Entfaltungsfreiheit nicht durch Verbote aus antiken Zeiten einengen. Weltliches Wachstum erforderte finanzielle Ressourcen. Dafür war man bereit zu zahlen. Überregional organisierte Kreditmärkte entstanden. Die Amsterdamer Börse wurde gegründet.
Der Zins überdauerte nicht nur das kanonische Verbot, welches Anfang des 20. Jahrhunderts schließlich aufgehoben wurde. Er überstand auch die Planwirtschaft sowjetischen Zuschnitts und die verquasten Ideen der Nationalsozialisten von einer völkisch motivierten Solidargemeinschaft.
Im Islam sind Aufschläge tabu
Marx sah im Privateigentum an Produktionsmitteln die Quelle der Ausbeutung des Arbeiters. Im Zins, der Bestandteil des Mehrwerts sei, werde dem Arbeiter ein Teil seines Arbeitsertrages vorenthalten. Im real existierenden Sozialismus war der Zins denn auch folgerichtig abgeschafft, offiziell wenigstens. In der Praxis merkte man schon bald, dass man auf seine Steuerungsfunktion bei der Allokation von Geldern nicht verzichten konnte. In der DDR führte Walter Ulbricht den Zins Anfang der sechziger Jahre wieder ein. Im Rahmen des „Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung“, kurz NÖSPL, hieß er nun Produktionsfondsabgabe. Unternehmen hatten dem Staat zwangsweise Kredite abzunehmen und mussten diesen nicht nur mit Teilen ihrer Gewinne, sondern auch durch die Zahlung von Zinsen alimentieren.
Bei den Nationalsozialisten war die Forderung, die „Zinsknechtschaft des Geldes“ zu brechen, fester Bestandteil des Parteiprogramms. Um die Industriebosse an Rhein und Ruhr zu beruhigen, wusste man ideologisch freilich zwischen „schaffendem“ Industriekapital und „raffendem“ Finanzkapital zu unterscheiden. Letzteres bezeichnete als Synonym jüdische Bankiers, die als Sündenbock für Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit dienten.
In der islamischen Gesellschaft gilt der Zins auch heute noch als Fremdkörper. „Und was immer ihr an Riba verleiht, damit es sich mit dem Gut der Menschen mehre, es vermehrt sich nicht vor Allah“; offenbarte der Prophet in Mekka, 622 nach Christus (Sure 30:39). Riba heißt so viel wie ungerechtfertigte Bereicherung und schließt den Zins – bezeichnenderweise – mit ein. Darlehen würden aus Solidarität vergeben, so die Lehre des Islam, nicht aus Profitgier. Geld sei zudem nur als Bote (Tauschmittel) und Richter (Wertmesser) tauglich und dürfe nicht durch Zurückhalten und Verleihen zweckentfremdet werden.
Die moralische Verdammung des Zinses durch die Jahrhunderte beantwortet freilich nicht die Frage, warum es den Zins überhaupt gibt, sondern fordert sie gerade heraus. Warum muss man mehr Geld zurückzahlen, als man bekommen hat, obwohl Geld nicht abgenutzt wird?
Die Frage geht an Hans-Christoph Binswanger, einem emeritierten Professor für Volkswirtschaft an der Universität St. Gallen. Der Mann hat ein Buch über Zins und Gewinn verfasst (Geld und Wachstum) und kann die einzelnen Theorien, die sich um das Phänomen Zins ranken, schnell runterbeten, allerdings nicht, ohne auch gleichzeitig in ihre Kritik einzusteigen.
Für die Klassiker, wie Adam Smith, ist der Zins ein Teil des Profits, den der Schuldner mithilfe von Produktionsmitteln erworben hatte, die durch Kredite finanziert worden waren. Dieser stand nun dem Gläubiger zu. Klingt plausibel und auch Binswanger sagt diese Theorie noch am ehesten zu. Ihr Schönheitsfehler jedoch: Auch derjenige Schuldner hat Zinsen zu entrichten, der keinen Gewinn macht.
Die Neoklassiker wollen den Entleiher belohnen, der auf seinen gegenwärtigen Konsum zugunsten des Schuldners verzichtet. „Man kann aber auch aus anderen Gründen auf Konsum verzichten als nur wegen Zinsen“, sagt Binswanger, „zum Beispiel, um fürs Alter zu sparen.“
Also, zur Seite damit, und das Blickfeld frei für John Maynard Keynes. Der US-Ökonom spricht von Zins als Liquiditätsprämie, die Menschen für die Annehmlichkeit und Sicherheit, die Geld bietet, zu zahlen bereit seien. Geben sie diese Annehmlichkeit auf, verlangen sie nach einer Belohnung – dem Zins. Binswanger freilich überzeugt der Grundgedanke, wonach es eine Prämie für gehaltenes Geld gäbe, nicht: „Wegen der Tatsache allein, dass ich Geld nur halte, kriege ich noch gar nichts.“
Ernüchterndes Ergebnis der Nachfrage: Ökonomen können die Höhe von Zinsen zwar recht einfach berechnen, indem sie einem vom Schuldner abhängigen Risikozuschlag zur Inflation addieren, die sie für die Dauer des Darlehens erwarten. Aber, so Binswanger: „Die Frage, warum es Zinsen gibt, hat die Ökonomie bis heute nicht gelöst. Dies ist eine moralische Frage, die der Ökonom nicht los wird.“ Womit wir beim Anfang wären.