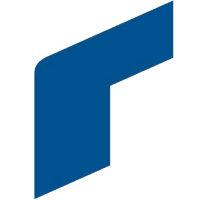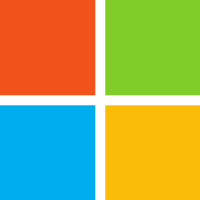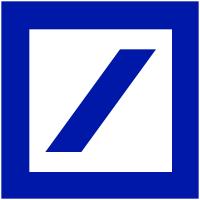Ü B E R N A H M E - A N G S T
Treuloses Kapital
Die Deutschland AG löst sich auf. Konzernlenker suchen verzweifelt nach Wegen, ihre Firmen vor der Zerschlagung zu bewahren.
Muss sich so einer fürchten vor Gott und der Welt oder der Allianz? Der Mann, von mächtiger, bulliger Statur, pflegt ein kraftvolles Niederbayerisch und führt ein stolzes Dax-Unternehmen, das Münchener Maschinenbaukonglomerat MAN mit knapp 30 Milliarden Mark Umsatz.
Muss sich Rudolf Rupprecht (60) etwa sorgen, weil am 15. Dezember, dem Tag der MAN-Hauptversammlung, "anstelle von Herrn Dr. Schulte-Noelle für die verbleibende Amtszeit des Aufsichtsrats Herr Dr. oec. Paul Achleitner" gewählt wurde?
Er muss nicht, aber er sollte.
Denn hinter der unspektakulär anmutenden Personalie verbirgt sich Brisantes, vielleicht sogar Bedrohliches.
Der listig-wuselige Investmentbanker Achleitner (42), im Vorstand des MAN-Hauptaktionärs Allianz zuständig für Beteiligungen, wird, so ist zu erwarten, mit Nachdruck darauf drängen, dass sich das Engagement beim chronisch unterbewerteten Mischkonzern besser rentiert.
Oder er wird sich von den Anteilen trennen. Ab 2002 ist das so lukrativ wie noch nie, weil steuerfrei.
Das große Zittern hat eingesetzt in den Vorstandsetagen der deutschen Unternehmen; existenzielle Fragen treiben die Topmanager um: Wie lange können wir noch auf die Treue unserer Großaktionäre bauen? Wem gehören wir künftig? Droht gar die Zerschlagung? Schließlich sind die Einzelteile eines Konzerns häufig bedeutend mehr wert als das künstlich zusammengehaltene Ganze.
Ob Bayer oder Eon, MAN oder Metallgesellschaft: Kaum ein Industrieschwergewicht scheint noch gefeit gegen eine Übernahme. Sogar Finanzgewaltige wie die Dresdner Bank, einst selbst beim Verschachteln der deutschen Wirtschaft aktiv, sind gefährdet.
Aufgeschreckt ringen die Konzernlenker in diesen Monaten um die Zukunft ihrer Unternehmen, reden daniederliegende Börsenkurse hoch und stützen sie durch den Rückkauf ihrer Aktien, umschmeicheln ihre Altaktionäre, suchen Verbündete hier, Helfershelfer dort.
Welch Wandel: Über viele Jahre hatten die Unternehmensführer ein leidlich bequemes Arbeiten, konnten in Ruhe Strategien entwickeln und wieder verwerfen - die Anteilseigner verziehen vieles, solange die Zahlen halbwegs stimmten. Und stimmte manchmal gar nichts, wie zuletzt im Fall Holzmann, blieben sie erst recht dabei; ein Ausstieg bei Schieflage hätte unerträgliche Gesichts- und Bilanzverluste zur Folge gehabt.
Das ist Geschichte. Die alte Deutschland AG, das dichte Geflecht aus Banken, Versicherungen und Industrie, zerfällt. Neue Eigentümer kriegt das Land: flexibler, fordernder, fremder - ohne traditionalistische Fesseln und politische Rücksichten.
Der weltweite Hyperwettbewerb und der stetig wachsende Druck der Finanzmärkte zwingen die Unternehmen schon in einen Kräfte zehrenden Restrukturierungswettlauf. Jetzt wird das Tempo noch einmal verschärft - dank Bundesfinanzminister Hans Eichel: Konzerne, die Beteiligungen verkaufen, müssen ab 2002 keine Steuern mehr auf Veräußerungsgewinne zahlen - Firmen können künftig hin- und hergeschoben werden, ohne dass der Fiskus mit verdient.
Für das kommende Jahr wird eine neue, gewaltige Deal-Welle erwartet. Einen "Ansturm" auf die Investmenthäuser, eine "extreme Boomzeit" sieht Stephan Krümmer voraus, Geschäftsführer der M&A-Firma Rothschild in Frankfurt, und fürchtet "personelle Engpässe".
Wer sich nicht selbst schnell genug entflicht, seine Performance nicht rechtzeitig bessert, für den besorgt am Ende ein unerwünschter Aufkäufer das Geschäft. Ein Rennen der Konzerne gegen die Zeit hat begonnen - in Heidelberg zum Beispiel.
Die dortige Druckmaschinen AG, eine 56-prozentige RWE-Tochter, gehört nicht mehr zum Kerngeschäft des Essener Stromversorgers. Sobald RWE-Chef Dietmar Kuhnt Geld braucht für teure Zukäufe bei Strom, Gas oder Wasser, will er sich von seinen Finanzbeteiligungen trennen.
Über den Verkauf der RWE-Bautochter Hochtief werden bereits Gespräche mit amerikanischen Interessenten geführt. Dass es auch in ihrem Fall so weit kommt, wollen die Heidelberger unbedingt vermeiden. Nichts fürchten sie mehr, als von Kuhnt an einen finanzstarken ausländischen Konkurrenten wie Canon oder Hewlett-Packard weitergereicht zu werden. Dann droht der schmucken Firma das Zerlegen.
Nun will Heideldruck-Chef Bernhard Schreier in Absprache mit den Großaktionären das Gewicht der Kleinanleger erhöhen. In einem ersten Schritt sollen RWE und der 24-Prozent-Aktionär Almüco (Allianz, Münchener Rück, Commerzbank) zunächst 16 Prozent ihrer Aktien abgeben, um den Streubesitzanteil über 30 Prozent zu hieven. Aber werden die Anleger den Einsatz honorieren?
Sicher ist: Allzu viel Schonfrist gewähren die Großaktionäre den Managern ihrer Beteiligungsunternehmen nicht. Vor allem die Banken und Versicherungen, selbst Getriebene des Kapitalmarktes, machen Druck. Zwar werde man auch in Zukunft Beteiligungen halten und neue eingehen, versichert Allianz-Chef Henning Schulte-Noelle, aber die Steuerreform ermögliche "ein noch aktiveres Umschichten des Portfolios".
Der Versicherer will sich zunächst steuerschonend von Eon-, BASF- oder Münchener-Rück-Aktien trennen, mit Hilfe einer Wandelanleihe. Die soll mit Papieren einer dieser Gesellschaften zurückgezahlt werden.
Der gesamte Steuervorteil der Allianz durch das Auflösen stiller Reserven wird auf rund 20 Milliarden Mark taxiert; bei der Deutschen Bank sind es nur ein paar Milliarden weniger.
Kreditinstitute und Assekuranz kontrollieren zwei Drittel des Börsenwerts der 30 Dax-Unternehmen. Die Geldgurus wollen den Austausch solcher Vermögensmengen so diskret wie möglich erledigen, zumindest wenn große Aktienpakete verschoben werden sollen.
Am 14. November 2000 hatte die Verschwiegenheit allerdings kurzzeitig ein Ende. Da meldete sich Axel Pfeil, Vorstandsvorsitzender der DB Investor, zu Wort; die Gesellschaft verwaltet die Unternehmensbeteiligungen der Deutschen Bank im Wert von rund 40 Milliarden Mark.
Der gesamte Besitz, kündigte Pfeil an, werde mit Beginn der Steuerreform veräußert, Detailliste - von DaimlerChrysler bis WMF - anhängig; spätestens 2007 solle alles aus den Büchern verschwunden sein.
Deutschlands Industrieführer waren konsterniert.
Tags darauf surrten in der Deutsche-Bank-Zentrale die Telefone. Mitten in der Chrysler-Krise, schimpfte ein Vorstandsmitglied des designierten Verkaufskandidaten DaimlerChrysler, "waren wir über solche Äußerungen nicht gerade beglückt".
Die Beschwerden wirkten. Vom europäischen Bankertreffen in Frankfurt versuchte Deutsche-Bank-Chef Rolf-E. Breuer die Gemüter zu beruhigen: Sicher, säuselte Breuer, wolle man sich von Industriebeteiligungen trennen, allerdings "ohne festen Zeithorizont"; schließlich erforderten Veräußerungen "Kreativität".
An Ideenreichtum mangelt es indes nicht. Im Vorgriff auf die Nullsteuerzeit wurden einige Deals bereits abgewickelt, fiskalisch findig gestaltet (siehe Kasten Seite 66). Manches ging allerdings daneben, im Übereifer, man übt halt noch.
Zum Beispiel bei der HypoVereinsbank in München. Die Bayernbanker verkauften Ende Juni knapp 2 Prozent Aktien des Energieriesen Eon. Der Erlös war bescheiden, viel schlimmer aber: Eon-Chef Ulrich Hartmann war zutiefst verstimmt.
Anders als gemeinhin üblich war Hartmann nicht vorab informiert worden und konnte somit auch keinen Einfluss darauf nehmen, bei welchem Investor die Anteile platziert werden. Hartmann hatte begründete Furcht vor einer Übernahme. Das gilt in Zukunft erst recht. Wenn Eon alle geplanten Firmenverkäufe realisiert, hat der Konzern fast so viel Geld in der Kasse wie das Unternehmen an der Börse wert ist, rund 90 Milliarden Mark.
Spätestens nach der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone ist den Konzernlenkern hier zu Lande klar geworden, dass schiere Größe keinen Aufkäufer mehr schreckt.
Die effektvollste Take-over-Strategie besteht zweifellos im Bündeln von Anteilen. In vielen Konzernen wie Metallgesellschaft oder Linde halten gleich mehrere Banken oder Versicherungen Aktienpakete in nennenswerter Größenordnung. Gelingt es, drei oder vier Großaktionäre gegen einen satten Aufpreis - zur Abgabe zu bewegen, ist die Hauptversammlungsmehrheit schnell beisammen: Bei durchschnittlichen Präsenzzahlen reichen womöglich schon etwas mehr als 30 Prozent zur Machtergreifung auf dem Aktionärstreff.
Wie können die Unternehmenslenker auf die neue Shareholder-Zeit reagieren?
DaimlerChrysler vertraut, fürs Erste, auf das Gespräch mit den Altinvestoren. Beim schwächelnden Autobauer sind das in erster Linie die Deutsche Bank, die rund 12 Prozent des Unternehmens besitzt, und der Staat Kuwait (7 Prozent).
Die Deutsche Bank (ein Daimler-Vorstand: "Da machen wir uns nichts vor") wird über kurz oder lang verkaufen. Das Golf-Scheichtum, im Ruf eines langfristig interessierten Anlegers, wollen die Stuttgarter deshalb auf keinen Fall als Stammaktionär verlieren.
Zumal im Falle des dritten bedeutenden Anteilseigners wohl nichts mehr zu retten ist. Bei Kirk Kerkorian ließ die Kontaktpflege zu wünschen übrig; seit der Fusion von Daimler und Chrysler im November 1998 hat Konzernlenker Jürgen Schrempp den einstmaligen Chrysler-Großaktionär nicht mehr getroffen.
Nun lässt der Amerikaner seine Anwälte sprechen und verlangt 20 Milliarden Mark Schadenersatz von DaimlerChrysler. Der dramatische Wertverlust des Unternehmens an der Börse hat Kerkorian so richtig gegen Schrempp und seine Vorstandstruppe aufgebracht.
Was die deutschen Industrieführer besonders nervt: Die Waffen sind ungleich verteilt. Während Angreifer auf ein volles Arsenal zurückgreifen können, setzt das deutsche Aktienrecht einer wirkungsvollen Defensive enge Grenzen. Das in Arbeit befindliche Übernahmegesetz wird die Vorstände womöglich noch stärker kujonieren und im Verteidigungsfall zum Stillhalten verdammen.
Deshalb muss der Schwächere rechtzeitig vorsorgen und sich die Dienste von Helfershelfern sichern. Kajo Neukirchen etwa, der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Metallgesellschaft, hat dauerhaft die M&A-Fachleute von Goldman Sachs und Morgan Stanley unter Vertrag genommen. Die Metallgesellschaft (neuerdings: mg technologies) gilt trotz der Metamorphose zum Technologiekonzern als besonders zerschlagungsgefährdet. Der Konzernverbund, klagt ein Großaktionär, mache "keinen Sinn": "Ich wollt', ich hätte dort keine Anteile mehr."
Die Frühbucheraktion bietet Neukirchen die Gewähr, dass die engagierten Berater nicht gegen ihn arbeiten. Der Preis: ein Pauschalhonorar, angereichert mit Exklusivmandaten bei lukrativen Zukäufen.
Neukirchens Kollege Manfred Schneider, Chef des Leverkusener Chemiegiganten Bayer, heuerte unter anderem die Investmentbanker von Credit Suisse First Boston und Deutscher Bank an. Als Abwehrmaßnahme gegen eine drohende feindliche Übernahme des Schweizer Pharmariesen Roche, mutmaßen Insider; zur weiteren Entwicklung der Konzernstrategie, gibt Bayer vor.
Conti-Chef Stephan Kessel sucht dagegen Zuflucht bei seinen wichtigsten Kunden; er baut auf den Rückhalt der heimischen Kfz-Branche: Die wolle Conti in seiner jetzigen Form bewahren, redet er sich und den Autolenkern ein. Und ohne das Plazet von Schrempp, Piëch und Co. seien gravierende Einschnitte bei deutschen Zulieferern kaum möglich.
Die niedrige Aktienbewertung von Conti (Kessel: "Mir können bei dem Kurs die Tränen kommen") lädt zum Generalangriff geradezu ein. Bislang konnten solche Attacken vereitelt werden. Anfang der 90er Jahre scheiterte Reifenkonkurrent Pirelli mit einer feindlichen Übernahme; in der entscheidenden Phase fehlten den Italienern die Verbündeten und das Geld.
Heute ist die Kapitalbeschaffung das geringste Problem. Das weiß keiner besser als Preussag-Chef Michael Frenzel, der sich in den vergangenen drei Jahren mit zig Milliarden Mark einen Touristikkonzern zusammengekauft hat.

Für den Umgestalter bricht bald eine neue Ära an, und auf die will er sich angemessen vorbereiten. Preussag-Hauptaktionär WestLB (33 Prozent) steht vor dem Generationswechsel; Bank-Chef und Frenzel-Mentor Friedel Neuber geht Ende August in den Ruhestand; danach, da gibt sich Frenzel keinen Illusionen hin, kommt der Preussag-Anteil wohl bald auf die Verkaufsliste.
Also begab sich der Konzernführer beizeiten selbst auf die Reise nach einem WestLB-Ersatz. Ein Wettbewerber schied als neuer Großaktionär aus; schließlich ist Preussag auf dem Reisemarkt bereits die Nummer eins.
In seiner Not entdeckte Frenzel die kongeniale Verbindung zwischen globalem Reisen und weltweitem Kommunikationsgeschäft. Wunsch-Shareholder demzufolge: Multimedia-Giganten wie Bertelsmann oder Microsoft. Doch bislang sprang keiner der Auserwählten auf die Idee an. Nun sucht Frenzel weiter.
Gewollt oder ungewollt, Bundesfinanzminister Eichel hat Gewaltiges in Gang gesetzt. Er bricht mit seiner Steuerreform den Kitt aus jenem Gefüge, das die deutsche Wirtschaft seit Kriegsende zusammenhält.
Schemenhaft zeichnet sich bereits ab, was an die Stelle der altehrwürdigen Deutschland AG tritt: eine offenere, internationalere und wohl auch effizientere German Inc., in der:
eine neue Gattung von Aktionären dominiert, an kurzfristiger Wertsteigerung interessierte Anlegergruppen, die ihr Portfolio häufiger umschichten und für einen permanenten Kapitalfluss sorgen;
sich die ehemaligen Daueraktionäre aus dem Geldgewerbe auf moderne Finanzinvestments verlegen; allein DB Investor will jährlich vier Milliarden Mark in Wachstumsunternehmen stecken, zeitlich begrenzt und mit strikten Renditevorgaben;
ein neuer, nüchterner Umgangston herrscht zwischen Aktionären und Managern; Firmen und ihre Mitarbeiter, fürchtet DAG-Funktionär und Allianz-Aufsichtsrat Gerhard Renner, würden künftig nur noch "als Aktienpakete durch den Kapitalmarkt geistern".
Mit einem solchen Objektstatus wird sich auch MAN-Chef Rupprecht arrangieren müssen. Erste Erfahrungen hat er bereits gemacht. Als er mit dem italienischen Nutzfahrzeug-Konkurrenten Iveco über ein Bündnis verhandelte und die Gespräche wegen der strittigen Führungsfrage frühzeitig beenden wollte, drängte Hauptgesellschafter Allianz zum Weitermachen; aus dem Deal wurde dennoch nichts.
Jetzt steht Volkswagen vor der Tür. Der Autokonzern würde die MAN-Lkw-Sparte gern übernehmen. VW-Chef Ferdinand Piëch, wollen Eingeweihte wissen, habe schon einmal vorgefühlt - beim neuen MAN-Aufsichtsrat Achleitner.
Dietmar Student/Thomas Werres
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112273,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112274,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112275,00.html
gruß
proxi
Treuloses Kapital
Die Deutschland AG löst sich auf. Konzernlenker suchen verzweifelt nach Wegen, ihre Firmen vor der Zerschlagung zu bewahren.
Muss sich so einer fürchten vor Gott und der Welt oder der Allianz? Der Mann, von mächtiger, bulliger Statur, pflegt ein kraftvolles Niederbayerisch und führt ein stolzes Dax-Unternehmen, das Münchener Maschinenbaukonglomerat MAN mit knapp 30 Milliarden Mark Umsatz.
Muss sich Rudolf Rupprecht (60) etwa sorgen, weil am 15. Dezember, dem Tag der MAN-Hauptversammlung, "anstelle von Herrn Dr. Schulte-Noelle für die verbleibende Amtszeit des Aufsichtsrats Herr Dr. oec. Paul Achleitner" gewählt wurde?
Er muss nicht, aber er sollte.
Denn hinter der unspektakulär anmutenden Personalie verbirgt sich Brisantes, vielleicht sogar Bedrohliches.
Der listig-wuselige Investmentbanker Achleitner (42), im Vorstand des MAN-Hauptaktionärs Allianz zuständig für Beteiligungen, wird, so ist zu erwarten, mit Nachdruck darauf drängen, dass sich das Engagement beim chronisch unterbewerteten Mischkonzern besser rentiert.
Oder er wird sich von den Anteilen trennen. Ab 2002 ist das so lukrativ wie noch nie, weil steuerfrei.
Das große Zittern hat eingesetzt in den Vorstandsetagen der deutschen Unternehmen; existenzielle Fragen treiben die Topmanager um: Wie lange können wir noch auf die Treue unserer Großaktionäre bauen? Wem gehören wir künftig? Droht gar die Zerschlagung? Schließlich sind die Einzelteile eines Konzerns häufig bedeutend mehr wert als das künstlich zusammengehaltene Ganze.
Ob Bayer oder Eon, MAN oder Metallgesellschaft: Kaum ein Industrieschwergewicht scheint noch gefeit gegen eine Übernahme. Sogar Finanzgewaltige wie die Dresdner Bank, einst selbst beim Verschachteln der deutschen Wirtschaft aktiv, sind gefährdet.
Aufgeschreckt ringen die Konzernlenker in diesen Monaten um die Zukunft ihrer Unternehmen, reden daniederliegende Börsenkurse hoch und stützen sie durch den Rückkauf ihrer Aktien, umschmeicheln ihre Altaktionäre, suchen Verbündete hier, Helfershelfer dort.
Welch Wandel: Über viele Jahre hatten die Unternehmensführer ein leidlich bequemes Arbeiten, konnten in Ruhe Strategien entwickeln und wieder verwerfen - die Anteilseigner verziehen vieles, solange die Zahlen halbwegs stimmten. Und stimmte manchmal gar nichts, wie zuletzt im Fall Holzmann, blieben sie erst recht dabei; ein Ausstieg bei Schieflage hätte unerträgliche Gesichts- und Bilanzverluste zur Folge gehabt.
Das ist Geschichte. Die alte Deutschland AG, das dichte Geflecht aus Banken, Versicherungen und Industrie, zerfällt. Neue Eigentümer kriegt das Land: flexibler, fordernder, fremder - ohne traditionalistische Fesseln und politische Rücksichten.
Der weltweite Hyperwettbewerb und der stetig wachsende Druck der Finanzmärkte zwingen die Unternehmen schon in einen Kräfte zehrenden Restrukturierungswettlauf. Jetzt wird das Tempo noch einmal verschärft - dank Bundesfinanzminister Hans Eichel: Konzerne, die Beteiligungen verkaufen, müssen ab 2002 keine Steuern mehr auf Veräußerungsgewinne zahlen - Firmen können künftig hin- und hergeschoben werden, ohne dass der Fiskus mit verdient.
Für das kommende Jahr wird eine neue, gewaltige Deal-Welle erwartet. Einen "Ansturm" auf die Investmenthäuser, eine "extreme Boomzeit" sieht Stephan Krümmer voraus, Geschäftsführer der M&A-Firma Rothschild in Frankfurt, und fürchtet "personelle Engpässe".
Wer sich nicht selbst schnell genug entflicht, seine Performance nicht rechtzeitig bessert, für den besorgt am Ende ein unerwünschter Aufkäufer das Geschäft. Ein Rennen der Konzerne gegen die Zeit hat begonnen - in Heidelberg zum Beispiel.
Die dortige Druckmaschinen AG, eine 56-prozentige RWE-Tochter, gehört nicht mehr zum Kerngeschäft des Essener Stromversorgers. Sobald RWE-Chef Dietmar Kuhnt Geld braucht für teure Zukäufe bei Strom, Gas oder Wasser, will er sich von seinen Finanzbeteiligungen trennen.
Über den Verkauf der RWE-Bautochter Hochtief werden bereits Gespräche mit amerikanischen Interessenten geführt. Dass es auch in ihrem Fall so weit kommt, wollen die Heidelberger unbedingt vermeiden. Nichts fürchten sie mehr, als von Kuhnt an einen finanzstarken ausländischen Konkurrenten wie Canon oder Hewlett-Packard weitergereicht zu werden. Dann droht der schmucken Firma das Zerlegen.
Nun will Heideldruck-Chef Bernhard Schreier in Absprache mit den Großaktionären das Gewicht der Kleinanleger erhöhen. In einem ersten Schritt sollen RWE und der 24-Prozent-Aktionär Almüco (Allianz, Münchener Rück, Commerzbank) zunächst 16 Prozent ihrer Aktien abgeben, um den Streubesitzanteil über 30 Prozent zu hieven. Aber werden die Anleger den Einsatz honorieren?
Sicher ist: Allzu viel Schonfrist gewähren die Großaktionäre den Managern ihrer Beteiligungsunternehmen nicht. Vor allem die Banken und Versicherungen, selbst Getriebene des Kapitalmarktes, machen Druck. Zwar werde man auch in Zukunft Beteiligungen halten und neue eingehen, versichert Allianz-Chef Henning Schulte-Noelle, aber die Steuerreform ermögliche "ein noch aktiveres Umschichten des Portfolios".
Der Versicherer will sich zunächst steuerschonend von Eon-, BASF- oder Münchener-Rück-Aktien trennen, mit Hilfe einer Wandelanleihe. Die soll mit Papieren einer dieser Gesellschaften zurückgezahlt werden.
Der gesamte Steuervorteil der Allianz durch das Auflösen stiller Reserven wird auf rund 20 Milliarden Mark taxiert; bei der Deutschen Bank sind es nur ein paar Milliarden weniger.
Kreditinstitute und Assekuranz kontrollieren zwei Drittel des Börsenwerts der 30 Dax-Unternehmen. Die Geldgurus wollen den Austausch solcher Vermögensmengen so diskret wie möglich erledigen, zumindest wenn große Aktienpakete verschoben werden sollen.
Am 14. November 2000 hatte die Verschwiegenheit allerdings kurzzeitig ein Ende. Da meldete sich Axel Pfeil, Vorstandsvorsitzender der DB Investor, zu Wort; die Gesellschaft verwaltet die Unternehmensbeteiligungen der Deutschen Bank im Wert von rund 40 Milliarden Mark.
Der gesamte Besitz, kündigte Pfeil an, werde mit Beginn der Steuerreform veräußert, Detailliste - von DaimlerChrysler bis WMF - anhängig; spätestens 2007 solle alles aus den Büchern verschwunden sein.
Deutschlands Industrieführer waren konsterniert.
Tags darauf surrten in der Deutsche-Bank-Zentrale die Telefone. Mitten in der Chrysler-Krise, schimpfte ein Vorstandsmitglied des designierten Verkaufskandidaten DaimlerChrysler, "waren wir über solche Äußerungen nicht gerade beglückt".
Die Beschwerden wirkten. Vom europäischen Bankertreffen in Frankfurt versuchte Deutsche-Bank-Chef Rolf-E. Breuer die Gemüter zu beruhigen: Sicher, säuselte Breuer, wolle man sich von Industriebeteiligungen trennen, allerdings "ohne festen Zeithorizont"; schließlich erforderten Veräußerungen "Kreativität".
An Ideenreichtum mangelt es indes nicht. Im Vorgriff auf die Nullsteuerzeit wurden einige Deals bereits abgewickelt, fiskalisch findig gestaltet (siehe Kasten Seite 66). Manches ging allerdings daneben, im Übereifer, man übt halt noch.
Zum Beispiel bei der HypoVereinsbank in München. Die Bayernbanker verkauften Ende Juni knapp 2 Prozent Aktien des Energieriesen Eon. Der Erlös war bescheiden, viel schlimmer aber: Eon-Chef Ulrich Hartmann war zutiefst verstimmt.
Anders als gemeinhin üblich war Hartmann nicht vorab informiert worden und konnte somit auch keinen Einfluss darauf nehmen, bei welchem Investor die Anteile platziert werden. Hartmann hatte begründete Furcht vor einer Übernahme. Das gilt in Zukunft erst recht. Wenn Eon alle geplanten Firmenverkäufe realisiert, hat der Konzern fast so viel Geld in der Kasse wie das Unternehmen an der Börse wert ist, rund 90 Milliarden Mark.
Spätestens nach der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone ist den Konzernlenkern hier zu Lande klar geworden, dass schiere Größe keinen Aufkäufer mehr schreckt.
Die effektvollste Take-over-Strategie besteht zweifellos im Bündeln von Anteilen. In vielen Konzernen wie Metallgesellschaft oder Linde halten gleich mehrere Banken oder Versicherungen Aktienpakete in nennenswerter Größenordnung. Gelingt es, drei oder vier Großaktionäre gegen einen satten Aufpreis - zur Abgabe zu bewegen, ist die Hauptversammlungsmehrheit schnell beisammen: Bei durchschnittlichen Präsenzzahlen reichen womöglich schon etwas mehr als 30 Prozent zur Machtergreifung auf dem Aktionärstreff.
Wie können die Unternehmenslenker auf die neue Shareholder-Zeit reagieren?
DaimlerChrysler vertraut, fürs Erste, auf das Gespräch mit den Altinvestoren. Beim schwächelnden Autobauer sind das in erster Linie die Deutsche Bank, die rund 12 Prozent des Unternehmens besitzt, und der Staat Kuwait (7 Prozent).
Die Deutsche Bank (ein Daimler-Vorstand: "Da machen wir uns nichts vor") wird über kurz oder lang verkaufen. Das Golf-Scheichtum, im Ruf eines langfristig interessierten Anlegers, wollen die Stuttgarter deshalb auf keinen Fall als Stammaktionär verlieren.
Zumal im Falle des dritten bedeutenden Anteilseigners wohl nichts mehr zu retten ist. Bei Kirk Kerkorian ließ die Kontaktpflege zu wünschen übrig; seit der Fusion von Daimler und Chrysler im November 1998 hat Konzernlenker Jürgen Schrempp den einstmaligen Chrysler-Großaktionär nicht mehr getroffen.
Nun lässt der Amerikaner seine Anwälte sprechen und verlangt 20 Milliarden Mark Schadenersatz von DaimlerChrysler. Der dramatische Wertverlust des Unternehmens an der Börse hat Kerkorian so richtig gegen Schrempp und seine Vorstandstruppe aufgebracht.
Was die deutschen Industrieführer besonders nervt: Die Waffen sind ungleich verteilt. Während Angreifer auf ein volles Arsenal zurückgreifen können, setzt das deutsche Aktienrecht einer wirkungsvollen Defensive enge Grenzen. Das in Arbeit befindliche Übernahmegesetz wird die Vorstände womöglich noch stärker kujonieren und im Verteidigungsfall zum Stillhalten verdammen.
Deshalb muss der Schwächere rechtzeitig vorsorgen und sich die Dienste von Helfershelfern sichern. Kajo Neukirchen etwa, der Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Metallgesellschaft, hat dauerhaft die M&A-Fachleute von Goldman Sachs und Morgan Stanley unter Vertrag genommen. Die Metallgesellschaft (neuerdings: mg technologies) gilt trotz der Metamorphose zum Technologiekonzern als besonders zerschlagungsgefährdet. Der Konzernverbund, klagt ein Großaktionär, mache "keinen Sinn": "Ich wollt', ich hätte dort keine Anteile mehr."
Die Frühbucheraktion bietet Neukirchen die Gewähr, dass die engagierten Berater nicht gegen ihn arbeiten. Der Preis: ein Pauschalhonorar, angereichert mit Exklusivmandaten bei lukrativen Zukäufen.
Neukirchens Kollege Manfred Schneider, Chef des Leverkusener Chemiegiganten Bayer, heuerte unter anderem die Investmentbanker von Credit Suisse First Boston und Deutscher Bank an. Als Abwehrmaßnahme gegen eine drohende feindliche Übernahme des Schweizer Pharmariesen Roche, mutmaßen Insider; zur weiteren Entwicklung der Konzernstrategie, gibt Bayer vor.
Conti-Chef Stephan Kessel sucht dagegen Zuflucht bei seinen wichtigsten Kunden; er baut auf den Rückhalt der heimischen Kfz-Branche: Die wolle Conti in seiner jetzigen Form bewahren, redet er sich und den Autolenkern ein. Und ohne das Plazet von Schrempp, Piëch und Co. seien gravierende Einschnitte bei deutschen Zulieferern kaum möglich.
Die niedrige Aktienbewertung von Conti (Kessel: "Mir können bei dem Kurs die Tränen kommen") lädt zum Generalangriff geradezu ein. Bislang konnten solche Attacken vereitelt werden. Anfang der 90er Jahre scheiterte Reifenkonkurrent Pirelli mit einer feindlichen Übernahme; in der entscheidenden Phase fehlten den Italienern die Verbündeten und das Geld.
Heute ist die Kapitalbeschaffung das geringste Problem. Das weiß keiner besser als Preussag-Chef Michael Frenzel, der sich in den vergangenen drei Jahren mit zig Milliarden Mark einen Touristikkonzern zusammengekauft hat.

Für den Umgestalter bricht bald eine neue Ära an, und auf die will er sich angemessen vorbereiten. Preussag-Hauptaktionär WestLB (33 Prozent) steht vor dem Generationswechsel; Bank-Chef und Frenzel-Mentor Friedel Neuber geht Ende August in den Ruhestand; danach, da gibt sich Frenzel keinen Illusionen hin, kommt der Preussag-Anteil wohl bald auf die Verkaufsliste.
Also begab sich der Konzernführer beizeiten selbst auf die Reise nach einem WestLB-Ersatz. Ein Wettbewerber schied als neuer Großaktionär aus; schließlich ist Preussag auf dem Reisemarkt bereits die Nummer eins.
In seiner Not entdeckte Frenzel die kongeniale Verbindung zwischen globalem Reisen und weltweitem Kommunikationsgeschäft. Wunsch-Shareholder demzufolge: Multimedia-Giganten wie Bertelsmann oder Microsoft. Doch bislang sprang keiner der Auserwählten auf die Idee an. Nun sucht Frenzel weiter.
Gewollt oder ungewollt, Bundesfinanzminister Eichel hat Gewaltiges in Gang gesetzt. Er bricht mit seiner Steuerreform den Kitt aus jenem Gefüge, das die deutsche Wirtschaft seit Kriegsende zusammenhält.
Schemenhaft zeichnet sich bereits ab, was an die Stelle der altehrwürdigen Deutschland AG tritt: eine offenere, internationalere und wohl auch effizientere German Inc., in der:
eine neue Gattung von Aktionären dominiert, an kurzfristiger Wertsteigerung interessierte Anlegergruppen, die ihr Portfolio häufiger umschichten und für einen permanenten Kapitalfluss sorgen;
sich die ehemaligen Daueraktionäre aus dem Geldgewerbe auf moderne Finanzinvestments verlegen; allein DB Investor will jährlich vier Milliarden Mark in Wachstumsunternehmen stecken, zeitlich begrenzt und mit strikten Renditevorgaben;
ein neuer, nüchterner Umgangston herrscht zwischen Aktionären und Managern; Firmen und ihre Mitarbeiter, fürchtet DAG-Funktionär und Allianz-Aufsichtsrat Gerhard Renner, würden künftig nur noch "als Aktienpakete durch den Kapitalmarkt geistern".
Mit einem solchen Objektstatus wird sich auch MAN-Chef Rupprecht arrangieren müssen. Erste Erfahrungen hat er bereits gemacht. Als er mit dem italienischen Nutzfahrzeug-Konkurrenten Iveco über ein Bündnis verhandelte und die Gespräche wegen der strittigen Führungsfrage frühzeitig beenden wollte, drängte Hauptgesellschafter Allianz zum Weitermachen; aus dem Deal wurde dennoch nichts.
Jetzt steht Volkswagen vor der Tür. Der Autokonzern würde die MAN-Lkw-Sparte gern übernehmen. VW-Chef Ferdinand Piëch, wollen Eingeweihte wissen, habe schon einmal vorgefühlt - beim neuen MAN-Aufsichtsrat Achleitner.
Dietmar Student/Thomas Werres
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112273,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112274,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/...8,112275,00.html
gruß
proxi
 Werbung
Werbung