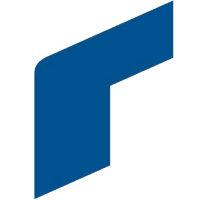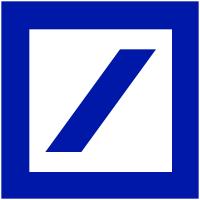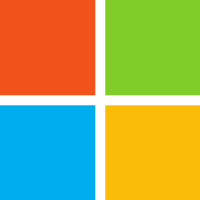Inhalt:
- Eine Analyse in vier Kapiteln
- Ex-Fidelity-Mann Wagner über die Flops der Fondsbranche
- Hall of Shame: Die größten Geldvernichter der Fondsindustrie
Ein dreister Griff in die Tasche
Hohe Kosten, miese Ergebnisse und fragwürdige Anlagepraktiken - zwei Jahre Börsenflaute haben die Schwächen der Investmentbranche gnadenlos bloßgelegt. manager magazin sagt, wie Sie künftig handeln müssen.
Das Schreiben war knapp und höflich im Ton, allein der Inhalt war alarmierend.
Mit dürren Worten kündigte die kanadische Fondsgesellschaft Orbitex im November 2001 dem Großteil ihrer deutschen Kunden die Geschäftsbeziehung und zog fünf ihrer acht in Deutschland zugelassenen Investmentzertifikate zurück.
Es war das jähe Ende einer ohnehin unglücklichen Verbindung. Die Kanadier gehörten mit Ausgabeaufschlägen von über 5 Prozent und einer durchschnittlichen Managementgebühr von 2 Prozent zu den teuren Anbietern auf dem deutschen Markt.
Die Höhe der Kosten stand allerdings nie im Einklang mit der Leistung. Allein im vergangenen Jahr verloren die vom Orbitex-Rückzug betroffenen Anleger über zwei Drittel ihres Kapitals.
Besonders hart traf es Investoren, die ihr Geld in den Rohstofffonds der Kanadier gesteckt hatten. Ende 2001 waren über 80 Prozent des Einsatzes weg - und das in einer Zeit, in der ähnliche Produkte im Schnitt nur 6,2 Prozent eingebüßt hatten.

Geschönte Zahlen: Mit welcher Rendite die Anbieter werben - und was beim Anleger ankommt
Eine der Hauptursachen für das schlechte Ergebnis: Der verantwortliche Manager Kenneth Hoffman ging mit dem Kapital seiner Anleger hochriskante Wetten auf kleine Nasdaq-Firmen ein. Verlustreiche Unternehmen wie der Solarzellenhersteller Astropower oder der Turbinenproduzent Capstone gehörten noch im Frühjahr 2001 zu den größten Anlagen des Fonds.
Das Abenteuer endete mit dem aus der Welt der Dotcoms hinlänglich bekannten Ergebnis: Der Fonds schmierte ab.
Hohe Kosten, schlechte Performance und eine fragwürdige Anlagestrategie - das Orbitex-Sündenregister dürfte vielen Anlegern vertraut sein. Die Masse der Kapitalanlagegesellschaften schnitt in den vergangenen Jahren vielfach ebenso schlecht ab wie der obskure kanadische Konkurrent (siehe: "Hall of Shame - Die acht größten Geldvernichter der Fondsindustrie").
Im Gleichschritt erhöhten die großen deutschen Fondsanbieter 2001 ihre Managementgebühren. Bis zu 100 Prozent mehr als bislang müssen die Anleger bei Adig, Dit, DWS und Co. für die Verwaltung ihres Kapitals hinblättern.
Und das, obwohl die Leistung alles andere als überzeugend war. Eine Untersuchung der Bad Homburger Vermögensverwaltung Feri Trust legt offen, dass es seit 1997 weniger als ein Viertel der auf Europa oder die USA spezialisierten Blue-Chip-Fonds schaffte, die Börsenindizes zu schlagen. Ein desaströses Resultat.
Die teilweise zweistelligen Wachstumsraten der Boomjahre erkauften sich viele Fondsmanager durch gewagte Anlagestrategien. Statt das Kapital ihrer Fonds auf viele verschiedene Unternehmen zu streuen, konzentrierten sich etliche Manager auf wenige Favoriten wie die Telekommunikationskonzerne Nokia oder Vodafone.
Manche Rentenfonds polierten ihre Performance gar mit Aktien vom Neuen Markt auf.
Die Quittung bekamen die Anleger nach dem Ende des Technologiebooms an den Weltbörsen. Viele der einstigen Spitzenpapiere schnitten deutlich schlechter ab als die Referenzindizes.
Was daraus folgt? Fonds sind keineswegs die günstigen oder unproblematischen Produkte, wie eine unheimliche Koalition aus Banken, Fondsgesellschaften und Anlegerzeitschriften in den vergangenen Jahren suggerierte. Als langfristiges Investment zur Absicherung der privaten Altersvorsorge taugen Fonds nur nach eingehender Prüfung.
manager magazin sagt, wie Sie vorgehen müssen. Eine Analyse in vier Kapiteln.
1. Die Gebührenfalle
Es ist eines der schlichten, aber gern verschwiegenen Gesetze des Fondsgeschäfts: Mit jedem Kaufauftrag und jedem Sparvertrag stellen die Anleger den Fondstöchtern der Banken eine Art Blankoscheck aus. Eine Vollmacht, die es den Investmentgesellschaften erlaubt, ihren Kunden nahezu alle Kosten in Rechnung zu stellen, die bei Auflage, Verwaltung und Vertrieb des Zertifikats anfallen.
Eine detaillierte Rechnung bekommen die Anleger jedoch nie zu sehen. Der Großteil der Aufwendungen ist in den zahlreichen Paragrafen der Rechenschaftsberichte versteckt und wird stillschweigend vom Kapital des Fonds abgezogen.
Das Verniedlichen und Verharmlosen der Kosten beginnt schon beim Kauf des Zertifikats. Was die Gesellschaften in ihren bunten Broschüren als Wertzuwachs präsentieren, hat wenig mit dem zu tun, was dem Kunden tatsächlich ausgezahlt wird.
Der Grund: In den Musterrechnungen werden sowohl die Ausgabeaufschläge als auch die steuerlichen Belastungen der Fonds ignoriert. Hierbei handelt es sich keineswegs um Kleinkram. So wurden Anlegern, die vor fünf Jahren 100.000 Euro in einen durchschnittlichen deutschen Aktienfonds investiert hatten, rund 11.000 Euro weniger überwiesen, als ihnen ursprünglich vorgerechnet worden war.
Was bei den Ausgabeaufschlägen beginnt, setzt sich bei den Managementgebühren fort, die den Anlegern für die Verwaltung ihres Kapitals in Rechnung gestellt werden. Zwischen 0,3 und 2 Prozent des Anlagebetrags sind Jahr für Jahr fällig. Vermeintliche Kleinstbeträge, die sich über einen längeren Zeitraum zu einer stattlichen Summe addieren.
Ein Beispiel zeigt die große Wirkung der kleinen Zahlen: Seit September vergangenen Jahres erhebt der AriDeka, der größte deutsche Aktienfonds, statt bislang etwa 0,7 Prozent eine Verwaltungsgebühr von einem Prozent. Bei einem Anlagebetrag von 100.000 Euro und einer jährlichen Wertsteigerung von 10 Prozent zahlt ein Kunde der Sparkassengesellschaft Deka in den kommenden zehn Jahren über 5500 Euro mehr.

Noch drastischer sind die Kostensteigerungen beim Uni-Fonds, dem auf deutsche Aktien spezialisierten Schwergewicht der Volks- und Raiffeisenbanken (plus 82 Prozent) oder dem Technologiefonds der Dresdner- Bank-Tochter Dit (plus 100 Prozent).
Auch die Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer, Buchhalter oder für die Depotbank, die Ausgaben für Druck und Versendung der Prospekte, ja sogar die knallbunten Werbebroschüren und Anzeigenkampagnen bezahlen die Anleger.
Insgesamt entstehen so pro Jahr noch einmal Kosten von rund einem halben Prozent des Anlagekapitals.
Wie hoch die tatsächliche jährliche Belastung eines Fonds ausfällt, lässt sich mit der so genannten Total Expense Ratio (TER) berechnen. Eine Kennzahl, die deutsche Fondsgesellschaften ihren Kunden - wie so vieles - lieber vorenthalten.
Das Londoner Analysehaus Fitzrovia hat für manager magazin die TER von über 4000 in Deutschland verkauften Zertifikaten untersucht und die teuersten Produkte herausgefiltert. Generell gilt:
- Je kleiner ein Fonds, desto höher die Kosten. Als König der Kassierer erwies sich der Nischenanbieter Value Management & Research, dessen Fonds meist auf ein Volumen von weniger als zehn Millionen Euro kommen. Die rekordverdächtige jährliche Kostenquote: 5,3 Prozent. Das ist mehr, als viele Gesellschaften als einmalige Gebühr beim Kauf eines Zertifikats fordern. Sie bildet normalerweise den größten Kostenblock eines Fondsinvestments.
- Fonds, die von den Luxemburger Tochtergesellschaften deutscher Geldhäuser verwaltet werden, langen besonders kräftig zu. Im Durchschnitt fallen bei diesen Produkten pro Jahr um etwa 50 Prozent höhere Gebühren an als bei vergleichbaren Fonds deutscher Anbieter.
- Branchen- und Themenprodukte sind weit riskanter und teurer als breit investierende Bluechip-Zertifikate. So zahlen Anleger für Internet- oder Telekommunikationsfonds fast doppelt so hohe jährliche Gebühren wie für Aktienfonds, bei denen der Investitionsschwerpunkt auf Dax- und M-Dax-Werten liegt.
Mit welcher Unverfrorenheit sich die Fondsgesellschaften bei ihren Kunden bedienen, zeigt das unrühmliche Beispiel der Deutsche-Bank-Tochter DWS. Trotz eines Verlusts von 70 Prozent stellte die DWS den Anlegern des New Markets Fonds Typ O ein Erfolgshonorar von insgesamt 5,9 Millionen Euro in Rechnung. Offenkundig ohne schlechtes Gewissen, schließlich hatte der Nemax All Share mit einem Minus von 82 Prozent noch ein paar Prozentpunkte mehr verloren.
Lektion 1: Analysieren Sie die Kosten des Fonds anhand des Rechenschaftsberichts. Hohe Gebühren sind nur dann gerechtfertigt, wenn sich der Fonds dauerhaft besser entwickelt und geringere Schwankungen aufweist als der Referenzindex.
2. Der Herdentrieb
Kaum ein Geschäftsmodell klingt ähnlich einfach und bestechend wie das der Fondsindustrie: Eine handverlesene Zahl erfahrener Experten sucht nach Erfolg versprechenden Unternehmen, verteilt anschließend die Kundengelder auf die unterschiedlichsten Branchen oder Länder und sorgt auf diese Weise dafür, dass der Anleger hohe Gewinne mit niedrigem Risiko einfährt.
Kaum ein anderes Geschäftsmodell war in den vergangenen Jahren allerdings weiter von der Realität entfernt. Es scheint, als habe seit Ende der 90er Jahre das Gesetz der Herde das eherne Prinzip der Risikostreuung abgelöst.
"Viele Fondsmanager nahmen einfach nur jene Werte ins Portfolio, die auch die Mehrzahl ihrer Kollegen gekauft hatte", sagt der ehemalige Mitarbeiter der US-Investmentgesellschaft Fidelity, Bruno Wagner.
Eine Studie der Bundesbank verweist das angeblich so umfangreiche Aktienresearch der Fondsmanager ins Reich der Legenden: Berufskollegen gehören demnach zu den wichtigsten Informationsquellen vieler Wertpapierprofis.
Tatsächlich dominierten Anfang 2000 Papiere von nur vier Unternehmen mehr als die Hälfte aller europäischen Aktienfonds. Es waren die Aktien der skandinavischen Telekom-Ausrüster Nokia und Ericsson, der Deutschen Telekom und des britischen Telekom-Dienstleisters Vodafone.
Welches Risiko die Fondsmanager mit ihrer kollektiven Wette eingegangen waren, erkannten die meisten Anleger erst, als die Notierungen ihrer Zertifikate ins Rutschen geraten waren: Bis Ende Februar sank der Börsenwert der vier Schwergewichte um 800 Milliarden Euro. Mit dem Absturz schmolz auch das Vermögen der Fonds.

Das Massenverhalten der Investmentprofis steht durchaus im Einklang mit der Produktpolitik der meisten Anbieter. Seit Jahren drücken die Gesellschaften verschiedene Branchen- und Themenfonds mit nahezu identischen Anlageschwerpunkten in den Markt.
Allein im Jahr 2000 starteten 60 Technologie- sowie 44 Biotech- und Pharmafonds. Auf diese Weise pumpten die Investmenthäuser immer neue Milliardensummen in ohnehin überbewertete Unternehmen.
Der Boom der Internet-, Telekom- und Biotech-Produkte zeigt, wie gering die Bereitschaft der Investmentindustrie ist, aus den eigenen Fehlern zu lernen. Schon während der Boomphase der Schwellenländer Osteuropas, Asiens und Lateinamerikas Mitte der 90er Jahre kreierten die Marketingkünstler der Branche zahlreiche Spezialzertifikate. Fonds, die kurz darauf von der Asienkrise in die Tiefe gerissen wurden und die sich von ihrem Absturz bis heute nicht richtig erholt haben.
Lektion 2: Werden Sie misstrauisch, wenn plötzlich alle Fondsmanager in Anlegermagazinen und Finanzblättern die gleichen Aktien empfehlen. Vergessen Sie Branchen- und Themenfonds. Diese Spezialzertifikate sind nur für Profis geeignet. Vielfach kommen diese Produkte erst dann auf den Markt, wenn die Kurse bereits stark gestiegen sind und das Verlustrisiko unverhältnismäßig hoch ist.
3. Der Etikettenschwindel
Es ist gar nicht so lange her, da war Kerstan von Schlotheim einer der Shootingstars der deutschen Fondsszene.
In den sechs Monaten zwischen Oktober 1999 und April 2000 schaffte der Manager des Adig-Plusfonds eine Wertsteigerung um 52 Prozent. Für einen Mischfonds, der laut Prospekt nicht nur in Aktien, sondern auch in weniger ertragsstarke Anleihen investiert, eine geradezu fabulöse Performance.
Dem Höhenflug folgte der tiefe Fall. Seit März 2000 verloren die Anteilsscheine fast die Hälfte ihres Werts. Der Grund für die Achterbahnfahrt: von Schlotheim setzte vor allem auf Titel vom Neuen Markt. Rentenwerte, die den Absturz nach dem Crash hätten abfedern können, kaufte der forsche Jungmanager erst, als es bereits zu spät war.
Die Metamorphosen des Adig-Plusfonds gehören zur gängigen Branchenpraxis, über die selbstverständlich niemand gern spricht.
Ein Teil der Manager dehnt die Anlagerichtlinien seiner Fonds bis zur Unkenntlichkeit. Der Blick in den Prospekt verschafft in den seltensten Fällen Klarheit. Die Anlagepolitik ist in den klein gedruckten Broschüren viel zu vage umschrieben.
Wenn das Depot beim besten Willen nicht mehr mit den vorgegebenen Anlagerichtlinien in Einklang zu bringen ist, verpassen viele Gesellschaften dem Fonds einfach stillschweigend einen neuen Anlagefokus.
Damit muten sie den Anlegern unter Umständen ungefragt ein deutliches Risiko zu. Eine Geschäftspolitik, die dem Charakter der Fonds als stabiles Langfrist-Investment fundamental widerspricht.
Dank eines wenig aussagekräftigen Namens war es zum Beispiel ein Leichtes, den Berenberg Universal Effekten Fonds vom Aktien- zum Rentenzertifikat umzumodeln, um ihn schließlich auf deutsche Dividendentitel zu fokussieren.
Selbst wenn der Name eines Fonds eindeutig klingt, können sich die Anleger nicht sicher sein, dass die darin enthaltenen Papiere auch zum Label passen. So investieren der Flexi-Rentenfonds (Allianz) oder der Platina-Rentenfonds International (Universal) schon seit längerem etwa 20 Prozent der Anlegergelder in Aktien.
Für die Investmentgesellschaft ist das durchaus rational. Aktien bessern die Ergebnisse zumindest kurzfristig auf. Eine Praxis, die Fonds in den Ranglisten von Analysehäusern und Anlegermagazinen auf Spitzenplätze katapultieren kann, was wiederum den Absatz ankurbelt.
Dass die Fonds bei diesem Spiel hohe Risiken eingehen, die viele Anleger mit dem Kauf eines sicheren Rentenzertifikats gerade vermeiden wollen, scheint für die Marketingstrategen der Investmenthäuser nebensächlich.
Offenbar ist den Fondsmanagern aber sehr wohl bewusst, dass sie mit der grenzenlosen Ausdehnung ihrer Anlagerichtlinien gegen die Interessen ihrer Kunden verstoßen. Nicht umsonst verschwinden verdächtige Positionen kurz vor dem Stichtag der Vermögensaufstellung für den Rechenschaftsbericht aus dem Portefeuille - eine Vorgehensweise, die branchenintern als "Window dressing" bekannt ist. Für kurze Zeit enthält der Fonds dann tatsächlich, was der Name verspricht - so lange, bis die Performance wieder ein wenig Politur benötigt.
Lektion 3: Prüfen Sie im Rechenschaftsbericht, welche Titel das Portfolio enthält. Analysieren Sie, welche Papiere der Manager im Laufe des Jahres gekauft und von welchen Aktien oder Anleihen er sich getrennt hat. Sind die Positionen riskanter, als es die vorgegebene Strategie vermuten lässt, oder kopiert der Fonds schlicht einen Index, sollten Sie die Finger von dem Produkt lassen.
4. Fazit
Die Erkenntnis gehört zu den einprägsamsten der vergangenen beiden Börsenjahre: Fondsmanager haben die Aura der Unfehlbarkeit verloren. Statt am Ende des Technologiebooms auf substanzstarke Werte zu setzen, hielten die meisten an ihren Lieblingen fest. Statt ihr Risiko mit höheren Bargeldbeständen zu reduzieren, beharrten nahezu alle Experten auf ihren Aktieninvestments.
Was der Anleger daraus lernen kann? Die Auswahl des richtigen Fonds ist ähnlich rechercheintensiv wie das Investment in eine Einzelaktie. Das Angebot ist ohnedies unübersichtlich genug - ist doch die Zahl der in Deutschland zugelassenen Aktien- und Mischfonds fast dreimal so hoch wie die Zahl der börsennotierten deutschen Aktiengesellschaften.
Wer diese Mühe scheut, sollte die gleiche Strategie wählen, die Pensionsfonds oder Lebensversicherer in den Vereinigten Staaten schon vor Jahren eingeschlagen haben: den Kauf von Indexfonds.
Diese so genannten passiv gemanagten Produkte beschränken sich darauf, Börsenbarometer wie den Dax oder den EuroStoxx abzubilden. Der Vorteil: Die Anleger schneiden in keinem Fall schlechter ab als der Gesamtmarkt, und die Produkte sind deutlich transparenter und kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds.
Es hat jedenfalls wenig Sinn, viel Geld für einen Fondsmanager auszugeben, der im Zweifel die gleichen Fehler macht wie der Börsenlaie.
Lektion 4: Börsengehandelte Indexfonds sind deutlich günstiger als aktiv gemanagte Produkte. Eine Übersicht aller an der Börse notierten Indexfonds finden Sie auf der Homepage der Deutschen Börse.
Steuertipps
Rentenfonds: Bei den Anleihezertifikaten greift der Fiskus kräftig zu. Zinserlöse, die den Freibetrag übersteigen, müssen Anleger voll versteuern. Zwar gelingt es guten Fondsmanagern, zusätzlich zu den Zinskupons steuerfreie Kursgewinne zu erzielen. Ein Anleger, der unter den Spitzensteuersatz fällt, muss trotzdem meist etwa ein Drittel der Erträge an das Finanzamt abführen.
Aktienfonds: Hier sind die Finanzbeamten gnädiger. Die Kursgewinne der Aktien im Fondsportfolio sind steuerfrei, wenn die Zertifikate nicht binnen eines Jahres wieder verkauft werden. Lediglich von den Dividenden fordert der Fiskus seinen Anteil. Mehr als ein Prozentpunkt der Rendite geht Anlegern durch das Finanzamt aber selten verloren.
Indexfonds: Die steuerliche Behandlung der börsengehandelten Papiere ist der von aktiv gemanagten Aktienfonds vergleichbar. Die Dividendeneinnahmen des Fonds müssen die Anteilshalter zu ihrem persönlichen Satz versteuern. Kursgewinne sind außerhalb der zwölfmonatigen Spekulationsfrist steuerfrei.
Unkontrollierbare Masse
Ex-Fidelity-Mann Wagner über die Flops der Fondsbranche
mm: Fondsmanager galten in den 90er Jahren als die Herrscher der Kapitalmärkte. Was ist von diesem Ruf nach zwei Jahren Baisse noch übrig?
Harter Kritiker: Branchenkenner Bruno Wagner wirft Fondsmanagern vor, zu hohe Risiken einzugehen und allein dem Herdentrieb zu folgen
Wagner: Nicht viel. Das ganze Getöse war für mich ohnehin nie nachvollziehbar. Der einzelne Fondsmanager hat wenig Entscheidungsspielraum. Die Investmentgesellschaft gibt einen Referenzindex vor, mit dem sie die spätere Performance weit gehend festlegt. Der Manager selbst ist also wenig mehr als ein Erfüllungsgehilfe.
mm: Der Fondsmanager wird für viele Konzernchefs schnell zur Bedrohung, wenn er massiv Aktien abstößt.
Wagner: Das stimmt nur dann, wenn viele Fondsmanager zur gleichen Zeit große Pakete auf den Markt werfen.
mm: Gerade weil sich die Mehrheit der Börsenprofis in die gleiche Richtung bewegte, ist der Absturz an den Börsen so extrem ausgefallen. Wie kommt ein solches Massenverhalten zu Stande?
Wagner: Gute Investmentideen verbreiten sich in der vernetzten Welt der Finanzindustrie mit rasender Geschwindigkeit. Hinzu kommt ein unglaublicher Druck, nichts falsch zu machen. Viele Fondsmanager orientieren sich deshalb an den Strategien ihrer Kollegen. Sie kaufen und verkaufen Aktien, weil alle anderen es auch tun. Das führt zu mächtigen, aber unkontrollierbaren Modewellen.
mm: Was heißt das für den Anleger?
Wagner: Die Eigendynamik dieser Wellen ist so groß, dass der überwiegende Teil der Fondsmanager den rechtzeitigen Ausstieg versäumt. Die meisten haben nach dem Ende der Technologieeuphorie den Wechsel zu substanzstarken Werten verpasst und stattdessen auf günstige Einstiegskurse bei den einstigen Stars gewartet - die Anleger zahlten dafür mit hohen Verlusten.
mm: Glauben Sie, dass die Fondsmanager ihre Lektion gelernt haben?
Wagner: Ich würde jede Wette eingehen, dass sich dieses Muster wiederholt. Man kann deshalb nur davor warnen, einem Fondsmanager viel zuzutrauen.
Hall of Shame
Die größten Geldvernichter der Fondsindustrie
Bernd Förtsch

Der einstige Neue-Markt-Guru erreichte auf unappetitliche Art Kultstatus.
Förtsch bestimmte als Berater die Aktienauswahl mehrerer Neuer-Markt-Fonds.
Ähnliche Tipps gab er anschließend in seiner Postille "Der Aktionär" zum Besten.
Inzwischen ist der Ruf ruiniert - die Fonds verloren teilweise über 70 Prozent.
Kurt Ochner

Der Börsenzauberer kaufte große Pakete kleiner Firmen und trieb so die Kurse.
Der Fehler im System Ochner: Bei fallenden Kursen implodierten die Fonds, weil er seine Titel nur noch zu Dumpingpreisen los wurde.
Auf diese Weise versenkte Ochner bereits zweimal Milliardenbeträge.
Anfang der 90er Jahre bei der SMH-Bank, zuletzt mit Neuer-Markt-Fonds von Julius Bär.
Heiko Thieme

In Branchenkreisen gilt der ehemalige Deutsch-Banker als der schlechteste Aktienfondsmanager der USA.
Sein American Heritage büßte selbst im Börsenboom der 90er Jahre über 30 Prozent seines Werts ein.
"Psycho-Heiko", wie ihn Kollegen an der Wall Street nennen, liebt hochriskante Wetten auf obskure Biotech- und Technologie-Papiere.
Jeffrey Vinik

Ende 1995 wettete der Manager des Fidelity Magellan mit einem Volumen von 90 Milliarden Euro der weltgrößte Aktienfonds - auf einen Einbruch an der Nasdaq.
Vinik kaufte Anleihen und verpasste die Tech-Hausse.
Der Fonds, unter Viniks Vorgänger Peter Lynch jahrelang besser als der S&P 500, fiel gegen den Index ab.
Vinik musste gehen und feierte später mit seinem Hedgefonds ein Comeback.
Peter Young

Der Ex-Starmanager der Deutschen Morgan Grenfell polierte seinen Europa-Fonds mit Aktien von Briefkastenfirmen und nicht börsennotierten Start-ups auf.
Bis der Schwindel aufflog, verloren die Anleger über 200 Millionen Euro.
Als ihn die Behörden vor Gericht stellten, trat er als Transvestit auf (Bild), seine Anwälte plädierten auf "unzurechnungsfähig" und kamen damit durch.
Bernie Cornfeld

Der einstige Taxifahrer mit Playboy-Allüren kaufte für seine Zertifikate Fonds und Aktien von Firmen, die er selbst gegründet hatte.
So kassierte seine Investors Overseas Services (IOS) die Anleger gleich mehrfach ab.
Das System brach Anfang der 70er Jahre zusammen, die IOS-Sparer verloren gut 500 Millionen Euro.
Volker Kuhnwaldt

Der Nordinvest-Mann räumte mit seinen ersten Internet-Fonds spektakulär ab.
Als er den Erfolg mit einem auf kleine asiatische Dotcoms spezialisierten Produkt wiederholen wollte, stürzte er ab.
Der pünktlich zum Höhepunkt der Börseneuphorie gestartete Nordasia.com verlor seither 80 Prozent.
Waddill Catchings

Catchings Trust verloren an der Wall Street über 90 Prozent ihres Werts
Der Chef der US-Investmentbank Goldman Sachs finanzierte die Aktienkäufe seiner Trusts - Vorläufer der heutigen Fonds - mit immensen Schulden.
Noch im Sommer 1929 baute Catchings große Aktienpositionen auf.
Die Trusts verloren nach dem Crash über 90 Prozent ihres Werts.
mm.de
Gruß
Happy End